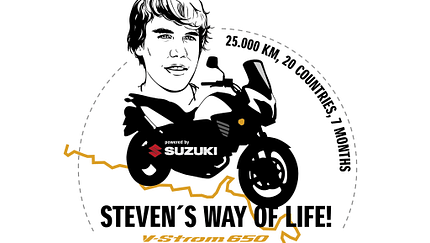15. April 2013
Da mein indisches Visum unfassbar lange auf sich warten liess, musste ich mich zehn Tage in der Region Kathmandu aufhalten. Nach Kurztrips nach Dhunche und Daman kehrte ich hoffnungsvoll nach Kathmandu zurück, wurde aber von den sehr unfreundlichen Mitarbeitern der indischen Botschaft enttäuscht. Mein Visum war nicht wie versprochen am Freitag fertig, sondern erst am Montag. Also schwang ich mich mit etwas Wut im Bauch zurück auf mein Motorrad und fuhr knapp 200 Kilometer ostwärts nach Jiri. Die kleine Bergstrasse wand sich bis auf 2.600 Meter den Berg hoch, um führte mich nach viereinhalb Stunden in die verschlafene Trekking-Stadt.
Nach einem entspannten Tag wollte ich nach Kathmandu zurückkehren, wurde aber vom Guesthouse Besitzer gewarnt, dass heute in ganz Nepal gestreikt wird. Das bedarf vermutlich einer kurzen Erklärung. Ein Streik in Deutschland bedeutet, dass niemand arbeitet, sich aber jeder frei bewegen darf. In Nepal gehen die Menschen – zumindest offiziell – weiterhin zur Arbeit, Busse, Motorräder, PKWs etc. dürfen aber nicht fahren. Das öffentliche Leben ist so praktisch lahmgelegt. Für mich war Kathmandu ohne das obligatorische Verkehrschaos schlichtweg unvorstellbar und so begab ich mich trotz der Warnungen auf den Weg.

Und zu meiner Überraschung war ich abgesehen von einigen Motorrädern tatsächlich das einzige Fahrzeug auf der Strasse. Etwa 70 Kilometer vor Kathmandu baten mich dann zwei Einheimische um Hilfe, die dringend in die nepalesische Hauptstadt mussten. Kurzentschlossen packte ich die zwei Jungs auf meine Suzuki DL650 und erreichte nur wenig später die Hauptverbindungsstrasse nach Kathmandu. Ab da wurde es so richtig haarig. Überall waren Menschenmassen, Sitzstreiks, Strassenblockaden, Militär und Polizei. Ich fühlte mich recht sicher, da ich durch meine Maschine klar als Tourist auszumachen war. Meine beiden Begleiter allerdings packte die blanke Angst. Immer wieder riefen sie mir zu: „Don't stop, just go. Don't stop for police, military or people. Never stop!“.
Als mich mein Hintermann dann noch krampfhaft umklammerte und zu beten begann, wurde auch ich etwas nervös. Plötzlich tauchte von rechts ein Mann mit einer zwei Meter langen Eisenstange auf, holte wütend aus und verfehlte uns nur um Haaresbreite. Ab diesem Moment brauchte ich keine Anweisungen mehr. Ich fuhr so schnell es irgendwie ging, dachte nicht mal mehr daran anzuhalten und wich z.T. auf der baulich getrennten Gegenfahrbahn den Strassensperren aus. Adrenalingeladen kamen wir nach einer gefühlten Ewigkeit in Kathmandu an und ich fuhr ohne Umwege zur Familie eines nepalesischen Freundes, die mich zu sich nach Hause eingeladen hatte.

Bei Haris und seiner Familie erfuhr ich ein beeindruckendes Mass an Gastfreundschaft und verliess am nächsten Morgen glücklich mit meinem indischen Visum Kathmandu. Ich hatte mir fest vorgenommen, den berühmt-berüchtigten Annapurna Circuit mit meiner DL650 zu bewältigen. Diese Herausforderung würde mich bis ins entlegene Manang führen. Nach einem langen Tag machte ich in Bensishar Station, bejubelte den Champions League Krimi des BVB und machte mich am nächsten Morgen früh auf den Weg Richtung Manang.
Nach nur 500 Metern hörte die asphaltierte Strasse auf und wurde zu einer Dirtroad, die mit jedem Kilometer steiler und felsiger wurde. Die Strasse wurde in den Fels gesprengt und ist überhaupt erst seit einigen Monaten befahrbar. Das war definitiv die härteste Strecke, die ich je gefahren bin. Sehr steile Anstiege und Abfahrten mit losem Geröll, Sand und Felsbrocken. Und als wäre das noch nicht genug wartete direkt neben der etwa zweieinhalb Meter breiten Strasse ein z.T. mehrere Hundert Meter tiefer Abhang.

Die ersten etwa dreissig Kilometer bis nach Jagat waren noch erträglich, dann wurde die Weiterfahrt aber zum Vabanque-Spiel. Durch Flussläufe waren Teile der Strasse aufgeweicht und derart matschig, dass ich mehrmals unkontrolliert rückwärts auf den Abgrund zu rutschte und nur durch Glück irgendwann wieder Grip hatte und das Schlimmste verhindern konnte. Als wäre das alles noch nicht genug, fing es auch noch zu hageln und wie aus Kübeln zu regnen an. Ich fahre mit normalen Strassenreifen, die auf Sand und Geröll erträglich, auf Matsch aber gänzlich untauglich sind. Kilometerlang setzte ich meine Schlitterfahrt fort, immer in der Hoffnung ein Dorf zu finden, in dem ich übernachten könnte.
Nach drei Stunden hatte meine Suche endlich ein Ende und ich konnte auf der anderen Seite der Schlucht eine kleine Ansammlung von Häusern erkennen. Davon trennte mich allerdings noch eine wenig vertrauenserweckende Hängebrücke, die nur schon vom Wind bedrohlich schwankte. Nach kurzem Zögern fasste ich mir ein Herz und kam glücklicherweise sicher auf der anderen Seite an.
Leider regnete es die gesamte Nacht hindurch, sodass die Fahrbahn am nächsten Morgen derart matschig war, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war. Schweren Herzens entschied ich mich umzudrehen. Ich liebe Abenteuer über alles und hätte es vielleicht schaffen können, aber es wäre ein unnötiges Risiko. Bei meiner Abreise habe ich meiner Familie versprochen, genau diese unkalkulierbaren Gefahren zu meiden und so machte ich mich vorsichtig zurück auf den Weg nach Bensishar.
Dieser Tag war bisher der mit Abstand gefährlichste Tag meiner Reise. Überraschenderweise nicht mal aufgrund der Strasse. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich im nächsten Blogeintrag ausführlich erzählen werde.
8. April 2013
Durch mein Auslandssemester in Bangkok habe ich dort noch viele Freunde und fühle mich inmitten des Staus und der Hektik der thailändischen Hauptstadt fast wie zu Hause. So liess mich eine Bekannte auf ihrer Couch schlafen und bereitete mir zusammen mit ihren Freunden eine fantastische Woche. Parties, Grillfeier auf einer Dachterasse, Muay Thai Unterricht und gemeinsames Kochen. Schöner hätte ich mir die durch den Motorradtransport anfallende Zwangspause gar nicht erträumen können.
Zum ersten Mal fiel es mir so richtig schwer, ein Land zu verlassen. Dennoch freute ich mich auf Nepal, da ich dort noch nie war und sicher viele neue Erfahrungen machen würde. Diese Hoffnung erfüllte sich schon auf der Fahrt vom Flughafen zum Guesthouse. In einem uralten Taxi holperten wir begleitet von einem ohrenbetäubenden Hupkonzert von einem Schlagloch ins nächste. Überall neue Farben, Gerüche und Dinge, die ich nicht verstand. Den Grossteil der Taxifahrt blickte ich staunend mit weit geöffnetem Mund aus dem milchigen Fenster – so fühlt sich also ein Kulturschock an.

Die ersten zwei Tage wanderte ich durch die unzähligen Gassen Kathmandus und probierte so viele der regionalen Spezialitäten wie möglich. Die Küche besteht mehr oder weniger aus indischen Gerichten und Momos, einem maultaschenartigen Snack, der mit Büffelfleisch gefüllt ist. Obwohl die Stadt mit ihrem absoluten Chaos einen gewissen Charme versprüht, war ich nach einem Wochenende doch heilfroh mein Motorrad am Cargo Office abholen zu dürfen. Die unzähligen Schlepper, Drogendealer, Bettler und Verkäufer waren mir auf Dauer einfach zu viel.
Im Cargo Office erwartete mich das gleiche Spiel. Sämtliche Formulare sind auf nepalesisch und es gibt keinerlei Schilder, die einem die Navigation durch das grosse Zollareal erleichtern. So wurde ein Schlepper unverzichtbar, der direkt mal stolze USD 100 forderte, um mein Motorrad durch den Zoll zu bekommen. Ich sagte ihm von Beginn an, dass ich keinen USD zahlen werde, ohne gesehen zu haben, dass er das Geld tatsächlich an einen Offiziellen gegen Rechnung übergeben hat. Er stimmte zu und nach etwa einer Stunde stand die riesige Holzbox vor mir, die direkt von etwa zehn begeisterten Nepalesen geöffnet wurde. Mit vereinten Kräften schraubten wir meine DL650 innerhalb von 30 Minuten zusammen und ich war startklar.

Mein Schlepper präsentierte mir letztlich eine handgeschriebene „Rechnung“ über zufälligerweise exakt USD 100. Beeindruckt von so viel Dreistigkeit fragte ich ihn nach tatsächlichen Belegen. Diese ergaben in Addition gerade mal USD 25, sodass ich ihm USD 30 in die Hand drückte, mich auf meine Maschine setzte und die Zündung betätigte. Wie erwartet rannten direkt sechs andere Schlepper herbei, um ihrem Betrügerfreund zur Seite zu stehen. Sie versuchten verzweifelt, mich am Wegfahren zu hindern, waren aber im direkten Duell mit meinen 69 PS nur zweiter Sieger. Mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen fuhr ich zurück zu meinem Guesthouse, um am nächsten Morgen endlich in die berühmten Berge Nepals fahren zu können.
Gegen 11:30 Uhr verliess ich Kathmandu und fuhr nordwärts nach Srybrensi. Dort wollte ich übernachten, um dann am nächsten Tag auf einer kleinen Schotterpiste bis zur tibetischen Grenze zu fahren. Die ersten etwa 50 Kilometer kam ich bestens voran. Die Strasse war zwar recht klein und hatte schon deutlich bessere Tage gesehen, aber die traumhafte Aussicht entschädigte für alles. Die ganze Zeit fuhr ich direkt am Berg entlang durch kleine Dörfer, Reisterrassen und Wälder; auf der einen Seite Fels, auf der anderen ein bis zu 200 Meter tiefer Abhang. Je weiter ich in die Berge erklomm, desto schlechter wurde der Strassenbelag. Immer wieder sah ich Erdrutsche, die anfangs noch geräumt wurden, aber mehr und mehr einfach plattgewalzt wurden und als Strassenersatz dienten.

Die nächsten etwa 15 Kilometer musste ich mich so über grobe Felsbrocken und tiefen Sand voran kämpfen. Immer mit konzentriertem Blick auf der Strasse, den sorgenvollen Gedanken aber beim Abhang, der jeden noch so kleinen Fehler unerbittlich bestrafen würde. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich endlich wieder asphaltierte Strassen und konnte für einige Minuten das spektakuläre Bergpanorama geniessen.
Als ich um 16:00 Uhr nur noch 1,5 Kilometer vor meinem Tagesziel Dhunche stand, erwartete mich an einem Militärcheckpoint eine böse Überraschung. Man brauchte für die Weiterfahrt eine Genehmigung, da ab hier der Nationalpark Langtang beginnt. Natürlich hatte ich dieses Dokument nicht und war auch nicht bereit, die geforderten 3.000 Rupi (EUR 30) zu zahlen. Umdrehen war auch keine Option, da ich das nächste Hotel niemals vor Sonnenuntergang erreichen würde. Ich blickte die Soldaten verzweifelt an, deutete auf meine Uhr sowie die sich bedrohlich nähernden Gewitterwolken und bat sie, mich doch wenigstens in der Stadt übernachten zu lassen. Am nächsten Morgen würde ich direkt wieder umkehren und mich bei ihnen abmelden. Glücklicherweise stimmten sie diesem Vorschlag zu und liessen mich auch ohne Ticket passieren.
Wie vereinbart brach ich nach einer kalten Nacht schon früh auf, meldete mich am Checkpoint ab und kehrte nach Kathmandu zurück, um dann weiter nach Daman zu fahren. Ab Kathmandu wählte ich kleine Feldwege und Dirtroads, um so der Hauptstrasse und dem dichten Schwerverkehr zu entgehen. Der Plan ging auf! Etwa drei Stunden holperte ich durch abgelegene Dörfer und landwirtschaftliche Anbaugebiete. Und endlich hatte ich auch meine ersten wirklich positiven Erfahrungen mit den Menschen. Versuchte noch in Kathmandu fast jeder mich zu betrügen, erfuhr ich im ländlichen Nepal plötzlich den Respekt, die Freundlichkeit und Gastfreundschaft, die ich mir so sehr erhofft hatte. Kinder riefen mir „Welcome to Nepal“ zu, Erwachsene erwiderten mein Kopfnicken beim Vorbeifahren mit einer leichten Verbeugung und bei jeder Trinkpause wurde ich herzlich von Einheimischen begrüsst. Einfach toll!
Nach einiger Zeit erreichte ich die Hauptstrasse und begann den Anstieg ins 2.300 Meter hoch gelegene Daman. Landschaftlich war diese Strecke bisher das absolute Highlight meines Nepalaufenthalts. Leider blieb mir nicht übermässig viel Zeit zum Geniessen, da die Sonne bereits langsam unterging und sich eine mächtige Gewitterfront bedrohlich näherte. Um kurz nach 18 Uhr erreichte ich zu meiner eigenen Überraschung trockenen Fusses mein Tagesziel und checkte direkt in einem Hotel mit TV im Zimmer ein. Auch im fernen Nepal darf ich natürlich das Champions League Viertelfinale meines BVB gegen Malaga nicht verpassen ;)
Leider reichte es nach starker Leistung nur zu einem 0:0, aber im Rückspiel regeln sie das schon noch. Ich hoffe, in den nächsten Tagen endlich mein indisches Visum zu bekommen. Dann kann ich westwärts nach Pokhara und zum Annapurna Circuit fahren, den ich versuchen werde mit meiner Suzuki DL650 zu erklimmen. Die Abenteuer nehmen also kein Ende und ich werde euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten!
1. April 2013
Sowohl Nordthailand als auch Nordlaos entwickeln sich mehr und mehr zum Geheimtipp unter Motorradreisenden. Gerade im Winter wenn das Motorrad in der Garage vereinsamt, bietet das Wetter in der Region beste Motorradbedingungen: Angenehme Temperaturen, Sonnenschein und fast nie Regen. Beide Länder verwöhnen mit kurvenreichen Bergstrecken, Abenteuer und fantastischem Essen. Ein neutraler Vergleich fällt mir etwas schwer, da ich mich hoffnungslos in Laos verliebt habe. In den letzten zwei Jahren bin ich drei Monate lang ca. 9.000 Kilometer durch den bergigen Binnenstaat gefahren. Gut 4.000 Kilometer davon habe ich während dieser Reise zurückgelegt. Im Norden Thailands erkundete ich in nur acht Tagen etwa 2.700 Kilometer der kleinen Bergstrassen rund um das Goldene Dreieck, was zumindest für einen grundlegenden Vergleich der beiden Länder ausreichend sein sollte.
Schon oft wurde ich gefragt, welches der beiden Länder ich denn empfehlen würde. Und wie fast immer lautete meine Antwort „es kommt drauf an“. Im Folgenden werde ich Laos und Thailand anhand von sechs Kategorien beschreiben und dann die Entscheidung jedem selbst überlassen. Es gibt unendlich viele Beweggründe zu reisen, sodass eine definitive Empfehlung meinerseits schlichtweg vermessen wäre. Hoffentlich helfen meine Erfahrungen etwas bei der Entscheidung und ich stehe natürlich gerne für Nachfragen bereit (www.facebook.com/stevensway.oflife).
Hier mein Video zu Nordlaos:
Hier ein Clip aus Nordthailand:
Strassenqualität
Die Strassen in Thailand sind durch die Bank in sehr gutem Zustand und kommen zum Teil sogar an deutsche Standards heran. Fast jede grössere Stadt lässt sich über drei- bis vierspurige Highways erreichen und selbst die normalen Hauptstrassen sind oft zweispurig oder so breit, dass mindestens drei Fahrzeuge nebeneinander fahren können. Sogar kleine Passstrassen sind in der Regel schlaglochfrei und gut befahrbar. Wenn man bewusst danach sucht – und das habe ich recht exzessiv gemacht – kann man den Norden Thailands auch auf winzigen einspurigen Strassen und Dirtroads erkunden. Diese sind dann natürlich etwas holpriger zu fahren, stellen aber immer noch absolut kein Problem dar.
Neben dem reinen Fahrspass bietet das gut ausgebaute thailändische Strassennetz auch grössere Freiheiten in der Routengestaltung. Man kann seine Tagesetappe sorgenfrei auf Nebenstrassen und Offroadstrecken umleiten, da man im Zweifelsfall über Hauptstrassen oder Highways innerhalb von einer bis zwei Stunden in der nächsten grossen Stadt ist. Dadurch kann man längere Tagesetappen fahren ohne Gefahr zu laufen, kein Hotel zu finden.Diesen Luxus bietet Laos definitiv nicht. Highways? Fehlanzeige! Für jemanden, der noch nie in Laos war, ist die Region kaum vorstellbar. Gesamt Nordlaos ist bergig, sodass sich praktisch jede Strasse in einem schier endlosen Kurvenmeer die steilen Schluchten hinauf schlängelt. Entsprechend klein sind daher auch die Hauptverkehrsstrassen mit nur jeweils einem Fahrstreifen pro Richtung und einer Breite, die kaum zwei Busse bzw. LKWs zulässt.
Dazu kommen unzählige Schlaglöcher, Sand, Kies und Schotter, was ein dauerhaftes Höchstmass an Konzentration erfordert. Entsprechend langsam kommt man auch nur voran. Ein Schnitt von 35 km/h ist ein durchaus realistischer Richtwert bei der Routenplanung. Verlässt man die Hauptstrassen, landet man unweigerlich offroad. Mit sehr viel Glück auf einer frisch angelegten Dirtroad, im Regelfall auf einer ausgewaschenen Lehmstrasse oder direkt auf einem Dschungeltrail. Brücken gibt es meist nur über die grössten Flüsse sodass ein jedes Offroadabenteuer mit diversen Flussdurchfahrten und Fähren garniert ist.
Dieser Punkt geht ganz klar an Thailand

Verkehr
Sowohl in Thailand als auch in Laos wird recht moderat gefahren. Thailand hat Linksverkehr, in Laos fährt man dank der französischen Kolonialherrschaft auf der rechten Seite. In Laos gibt es kaum Autos auf den Strassen, sodass das Risiko eines Verkehrsunfalls sehr gering ist. Auf Tiere muss man allerdings umso mehr aufpassen. Insbesondere Hunde und junge Schweine sind unberechenbar und zwangen mich schon das ein oder andere Mal zu einer Vollbremsung.
Das deutlich höhere Grundtempo auf thailändischen Strassen in Verbindung mit der um ein Vielfaches höheren Fahrzeugzahl birgt natürlich ein gewisses Risiko, das sich aber dennoch sehr in Grenzen hält. Zumeist werden die Strassenregeln eingehalten und auch als Motorrad erhält man meistens genügend Platz und wird nur selten von der Strasse gedrängt.
Dieser Punkt geht an Laos
Tankstellendichte
Weder in Thailand noch in Laos mangelt es an Tankstellen. Man sollte nicht unbedingt seine deutschen Tankgewohnheiten an den Tag legen, sondern schon nach einer Tankstelle Ausschau halten, wenn man noch 100 km weit fahren könnte. Selbst wenn der Sprit mal eng wird, kann man immer noch in fast allen Dörfern aus Fässern oder Flaschen tanken. Allerdings sollte das nur eine Notlösung sein, da der Sprit oft schon tagelang steht und zum Teil stark verunreinigt ist.
Unentschieden

Abenteuerfaktor
All das, was in der Rubrik „Strassenqualität“ für Thailand sprach, wirkt sich hier negativ aus. Nie muss man bangen, ob man am Abend ein Hotel finden wird; nie habe ich in Thailand mit dem Gedanken spielen müssen, im Dschungel zu schlafen. Als Motorradfahrer wird man zwar beachtet, aber die grosse Begeisterung der Einheimischen bleibt zumeist aus. Kinder winken kaum und selbst Offroadstrecken sind noch in sehr gutem Zustand. Echt Abenteuer sind daher in Thailand leider rar gesäht.
Laos hingegen ist Abenteuer pur! Selbst auf Hauptstrassen winken in jedem Dorf Kinder und schreien freudig ihr „Sabaidee“ (Hallo) heraus. Und sobald man auf kleinere Strassen ausweicht, wird auch die grösste Abenteuerlust gestillt werden. Dschungeltrails, steile Abhänge, felsige Passagen, Flussdurchfahrten, Matsch, Sand und Staub – all das innerhalb von 80 Kilometern! Wer nicht nur Kilometer abspulen möchte, sondern Geschichten erleben will, von denen er auch noch 20 Jahre später kopfschüttelnd berichtet, der muss nach Laos gehen.
Ganz klarer Punkt für Laos.
Essen
Laos hat zwar einige sehr gute Gerichte, man kann sie allerdings an einer Hand abzählen. Phô, meine allmorgendliche Suppe, ist eine vietnamesische Spezialität und viele der Hauptspeisen wurden aus Thailand übernommen. Daher kommt bei der laotischen Küche verhältnismässig schnell Langeweile
Die thailändische Küche ist dagegen einfach überragend! Vielfältig, extrem versiert und immer frisch. Ich war nun schon insgesamt gut neun Monate in Thailand und habe noch nicht mal annähernd alle Gerichte durchprobiert. Wem der kulinarische Aspekt beim Motorradfahren wichtig ist, sollte sich Thailand ganz dick anstreichen!
Klarer Punkt für Thailand

Kosten
Da nehmen sich beide Länder nicht wirklich viel. Bei meiner Art zu reisen sind Thailand und Laos exakt gleich teuer; ich habe jeweils gute 25 Euro pro Tag ausgegeben für Hotels, Essen/Trinken, Sprit, Eintritt und sämtliche weiteren Kostenpunkte. Verzichtet man auf etwas Komfort bei der Unterkunft und spart sich das Feierabend-Bier, kommt man sicher auch mit 15-20 Euro pro Tag aus.
Unentschieden
Letztlich muss nun jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig die einzelnen Kategorien sind. Für begeisterte Motorradfahrer, denen es primär um den Fahrspass geht, ist Thailand vermutlich die bessere Option. Wer etwas abenteuerlustiger unterwegs ist und sich für den kulturellen sowie menschlichen Aspekt der Reise interessiert, ist meiner Meinung nach in Laos besser aufgehoben. Ich zähle mich definitiv zur letzteren Fraktion und würde immer wieder freudestrahlend mit einem schlammverschmierten Motorrad durch winzige abgelegene Dörfer in Nordlaos fahren. Vielleicht trifft man sich ja bei der nächsten Tour mal – ich würde mich freuen!
21. März 2013
Nach sehr entspannenden drei Wochen in Nordlaos lief langsam aber sicher mein Visum ab und ich musste das tun, was ich ansonsten immer konsequent vermeide: Organisieren und einen Zeitplan erstellen.
Reist man über den Landweg nach Thailand ein, erhält man nur ein 15 Tage Visum, was mich etwas unter Zeitdruck versetzte. Um sicherzustellen, dass meine Suzuki sicher von Bangkok nach Kathmandu geliefert wird, muss ich bereits eine Woche vor Abflug in der thailändischen Hauptstadt sein und habe daher nur noch acht Tage für den Norden Thailands. Ausgerechnet die Region mit den spektakulärsten Strassen muss ich also im Schnelldurchlauf bereisen. Um dennoch einen guten Eindruck dieses Landesteils zu bekommen (und ihn in einem späteren Blogeintrag mit Nordlaos vergleichen zu können), werde ich sieben der acht Tage jeweils sieben bis zehn Stunden auf meiner DL650 verbringen.
Begonnen hat dieser Marathon um 7:30 in Luang Prabang, das ich in Richtung Udomxai verliess, um über Pak Beng und den Grenzübergang Nam Nguen nach Pua zu gelangen. Ich hatte mir fest vorgenommen, an diesem Tag die für laotische Strassenverhältnisse utopische Strecke von 500 Kilometern zurückzulegen. Die ersten gut 100 Kilometer bis nach Pak Mong vergingen wie im Flug und bescherten mir einen perfekten Start; die Strasse ist recht wenig befahren, gut ausgebaut und verhältnismässig gerade.

Das Schlimme waren nicht mal unbedingt die Strassenschäden selbst, sondern die dilettantischen Ausbesserungsarbeiten. Einige der grössten Schlaglöcher wurden einfach mit lockerem Sand und groben Steinen zugeschüttet, die sich mit der Zeit auf der gesamten Fahrbahn ausgebreitet hatte. Nach jedem LKW dauerte es etwa zwei Minuten bis sich der dichte Staub etwas gelichtet hatte und man auch ohne wildes Hupen sicher weiterfahren konnte. Bei etwa Kilometer 30 dieser Tortur passierte das, worauf ich schon zwei Monate gewartet hatte: Mein erster Reifenschaden. Ausgerechnet heute dachte ich mir. Aber was ist schon ein guter Zeitpunkt für eine Panne?
Glücklicherweise habe ich mir den Reifen nur an einem kleinen Metallsplitter aufgeschnitten, sodass genügend Luftdruck verblieb, um bei langsamer Fahrt die letzten 40 Kilometer bis nach Udomxai zurückzulegen. Bei jeder der winzigen Werkstätten war eine schauspielerische Meisterleistung gefragt, um ihnen verständlich zu machen, dass ich keinen Schlauch im Reifen habe und er daher nicht von der Felge genommen werden muss. Im fünften Laden hatte ich letztlich Glück. Nach einigen Hin und Her erkannte er das Problem und konnte meinen Reifen innerhalb von nur zwei Minuten flicken. Ich hatte sowieso schon geplant, mir in Chiang Mai ein Pannen-Reparatur-Set zu kaufen und werte diesen Zwischenfall als Weckruf und wertvollen Anschauungsunterricht zugleich.
In meinem Zeitplan hat mich dieser Zwischenfall eine wertvolle Stunde zurückgeworfen. Auf den 130 Kilometern nach Pak Beng musste ich also Tempo machen, durfte aber auf den Bergstrassen auch nicht übertreiben. Ein Sturz und schon ist der ganze Zeitgewinn – und womöglich meine weitere Reise – dahin. Um kurz nach 15 Uhr kam ich an der Fährstation an und hatte riesiges Glück. Eine fast voll beladene Autofähre hatte noch Platz für mich und setzte direkt zur Mekong Überquerung an. Das ersparte mir nicht nur gut 20 Minuten Wartezeit, sondern auch die klapprigen Holzstege der Motorradfähren, die für meine Suzuki schlichtweg zu klein sind.
Ich fasste neuen Mut und glaubte zum ersten Mal so wirklich, es schaffen zu können. Doch da hatte ich die Rechnung ohne die laotischen Grenzbeamten gemacht. Gegen 15:45 stand ich in Nam Ngeun an der Grenze zu Thailand, hatte bereits ausgestempelt und musste nur noch durch den Zoll. Eine Formalie dachte ich, da mich die Zollbeamten bei der Einreise einfach durchwinkten und weder Dokumente forderten noch ausstellten. Doch leider werden Bestimmungen in Laos offensichtlich nicht einheitlich umgesetzt. Mein freundlicher aber bestimmter Kontrolleur wollte auf Teufel komm raus irgendein Formular haben, das ich natürlich nicht vorweisen konnte. Ich redete ihm etwas gut zu, zeigte ihm nochmals meinen Pass und verkaufte ihm meinen Fahrzeugbrief als deutsches Importdokument. Das genügte ihm anscheinend, denn er gab mir direkt meinen Pass zurück und liess mich ohne Beanstandungen nach Thailand ausreisen.

Dort ging es gleich wesentlich professioneller zu. Nach zwei Minuten war mein Pass gestempelt und in der Zollstation bat man mich in ein klimatisiertes Büro, um mir ein temporäres Importdokument auszustellen. Um 17 Uhr war ich endlich fertig, musste allerdings auch einsehen, dass ich meine ursprünglich geplante Route niemals vor Einbruch der Dunkelheit beenden würde. Und so entschied ich mich für eine alternative, kürzere Wegführung, die mich letztlich um kurz nach 18 Uhr und mehr als 10 Stunden Fahrt in ein luxuriöses – und erstaunlich günstiges – Hotel in Pua führte.
Für den nächsten Tag hatte ich mir mit der Garmin-Software BaseCamp eine fantastische 500 Kilometer Bergtour über winzige Strassen und Feldwege zusammengeschustert. Und so sass ich schon um 8:00 auf meiner Suzuki und fuhr eine kleine Bergstrasse in Richtung Westen, als diese plötzlich nach 35 Kilometern einfach endete. Mein Montana 600 zeigte die Strasse ab diesem Punkt als „unbefestigt“ an, was eine unzulässige Beschönigung ist. Schon die gut 200 Meter, die ich einsehen konnte, waren extrem steil, sandig und hatten tiefe Spurrinnen. Aus Laos hatte ich noch eindrücklich in Erinnerung, wie tückisch diese Mischung ist, weshalb ich direkt umdrehte und das Stück auf der Strasse 1148 umfuhr. Eine gute Entscheidung, wie sich schnell herausstellen sollte.

Fast ohne Gegenverkehr fuhr ich gute 1,5 Stunden durch traumaft bergige Landschaften. Eine Kurve reihte sich an die nächste, sodass man nie wirklich aus der Schräglage herauskam; ein Gefühl wie Skifahren bei besten Pistenbedingungen. Und das war nur der Anfang dieses überragenden Fahrtages! Ab da ging es non-stop auf Bergstrassen ca. 400 Kilometer direkt entlang der laotischen und später burmesischen Grenze. In den Steigungen wurde Kaffee und Tee angebaut, der dann in luxuriösen Resorts auf der Passhöhe verkauft wurde. Leider richtete sich das Angebot primär an wohlhabende thailändische Touristen und überstieg mein Budget bei Weitem. Und so begnügte ich mich mit den spektakulären Strassen und einer würzigen Nudelsuppe an einem kleinen Strassenstand.
Nach etwa sechs Stunden erreichte ich das Goldene Dreieck (Laos – Thailand – Myanmar) und setzte meinen Weg von dort entlang der burmesischen Grenze fort. Hier wurden die Bergpässe noch steiler, schmaler und verlassener. Es gibt eigentlich nur drei Gründe, diese winzigen Wege zu befahren: Man wohnt dort, man fährt die Strasse zum puren Vergnügen oder man schmuggelt. Dementsprechend stark war die Militärpräsenz in dieser Region. Alle 10-20 Kilometer musste ich an einem Militärcheckpoint halten, erklären, wohin ich unterwegs bin und z.T. Meinen Pass zücken. Die Soldaten waren glücklicherweise durch die Bank sehr nett und ich passte offensichtlich nicht so recht in ihr Schmuggler-Profil, sodass sie mir zumeist nach zwei Minuten freundlich zulächelten und die Schranke öffneten. Ich konnte einfach nicht genug kriegen von diesen atemberaubenden Bergstrassen! Obwohl ich schon mehr als acht Stunden im Sattel sass, verlängerte ich die Etappe immer weiter, bis mich letztlich die untergehende Sonne wieder in erdnahe Sphären zurückholte.
Immer noch berauscht von der wilden Kurvenfahrt steuerte ich ein kleines Dorf an, in dem mich Feirns Familie zu sich nach Hause eingeladen hatte. Dort würde ich mich der nächsten Herausforderung stellen und mit Feirns Vater jagen gehen. Um kurz vor 18:00 Uhr erreichte ich das idyllisch gelegene Dorf lud mit den letzten Sonnenstrahlen mein Gepäck ab und wurde direkt mit einem Thai-Whiskey empfangen – besser geht’s nicht!
Nach einer schnellen Dusche hatte sich schon die gesamte Familie um einen reich gedeckten Tisch versammelt. Herrlich duftende nordthailändische Gerichte warteten auf mich: Schwein in frittierten Teeblättern, Salat aus Rindfleisch, Blut und Zwiebeln, verschiedene Suppen, Reis und natürlich mehr Thai-Whiskey. Es schmeckte herausragend gut! Müde, pappsatt, etwas beschwipst und überglücklich fiel ich schon um 21:00 Uhr ins Bett und schlief direkt wie ein Stein ein. Was für ein toller Start meines Thailand-Marathons! Wenn die weiteren Tage auch nur halb so schön werden, könnte das ein absolutes Highlight meiner Reise werden.
13. März 2013
Luang Prabang, laotische Hauptstadt während der französischen Kolonialherrschaft, ist UNESCO Weltkulturerbe und hat diese Auszeichnung auch mehr als verdient. Winzige Gässchen und zahlreiche Tempel laden zum Erkunden der im Kolonialstil errichteten Stadt ein. Weniger kulturaffine Besucher können Massagen, herausragendes laotisches Essen oder einfach ein eiskaltes Beerlao direkt am Ufer des Mekongs geniessen. Ich hingegen verbrachte – wie immer wenn ich in Luang Prabang bin – die meiste Zeit im Café Ban Vat Sen. Das alte französische Café liegt direkt gegenüber einer Schule, spielt im Hintergrund leise Jazz und serviert das beste Baguette der Stadt. Das noch heisse Brot in grobe Stücke brechen, sie grosszügig mit Cream Cheese bestreichen, Espresso trinken und dabei den Schulkindern beim Fussballspielen zusehen – herrlich!
Am nächsten Tag widerstand ich der französischen Verlockung und unternahm eine kleine Tagestour zum nahegelegenen Wasserfall Tat Kuang Si. Die knapp 30 Kilometer waren wie praktisch überall in Laos sehr kurvenreich, allerdings nicht sonderlich spektakulär und durch ein atypisches Hindernis durchaus anspruchsvoll: Wasserbüffel und Kühe trifft man überall auf laotischen Strassen an. Sie sind nicht übermässig gefährlich, da sie sich sehr vorhersehbar fortbewegen. Sind sie einmal losgelaufen, halten sie nicht mehr an und ändern weder ihre Geschwindigkeit noch Richtung.

Hunde und Schweine sieht man sogar noch häufiger – insbesondere in Nordlaos. Gerade Jungtiere sind oft unberechenbar und haben mich schon zu der ein oder anderen Vollbremsung gezwungen. Natürliche Selektion sorgt letztlich dafür, dass nur die vernünftigsten Tiere ein fortgeschrittenes Alter erreichen, weshalb ausgewachsene Schweine und Hunde kein Grund zur Besorgnis sind. Hühner, Gänse und Enten rennen überraschenderweise kopflos wie Hühner auf der Strasse herum; was genau sie vorhaben wissen wohl nur sie selbst. Allerdings lassen sie sich durch beherztes Hupen verscheuchen, was ihr Gefahrenpotential doch deutlich reduziert.
Touristen auf Rollern trifft man glücklicherweise nur an wenigen Orten an – Luang Prabang ist einer davon. Bei ihrem Fahrstil scheinen sie mit dem fahrbaren Untersatz gleichzeitig eine Aura der Unverwundbarkeit gemietet zu haben. Flip-Flops, T-Shirt, kurze Hosen und eine Extraportion Optimismus erfüllen ihr Sicherheitsbedürfnis. Blauäugig nehmen viele an, es gäbe keine Verkehrsregeln und missachten so die deutlich subtileren Verhaltensweisen auf asiatischen Strassen (z.B. ein Mal hupen = ich bin hinter dir, fahr genau so weiter; zwei Mal hupen = ich möchte überholen, fahr rechts ran; drei Mal hupen = du machst etwas grundlegend falsch...). Sie sind nicht nur unberechenbar, sondern reagieren auch noch meistens falsch auf die Hupsignale. So werden sie zu einer echten Gefahrenquelle, über die sich selbst die sonst so geduldigen Laoten mit Inbrunst aufregen. Hier hilft nur eins: Bremsen, sehr viel Abstand halten beim Überholen und so schnell wie möglich die Touristenregion verlassen.
Genau das machte ich zwei Tage später als ich Pak Beng, eine kleine Stadt nahe der thailändischen Grenze ansteuerte. Rainer Wolf von R.S. Wolf in Lampertheim war so grosszügig, mir Geld für Schulsachen zu geben, die ich in abgelegenen Dörfern verteilen sollte. Und so machte ich mich mit gefühlt 10 Kilogramm Heften, Bleistiften, Buntstiften, Linealen, Kulis, Radiergummis und Spitzern auf die Suche nach der Fährstation über den Mekong. Schnell wurde ich fündig und setzte nach einer kurzen Wartezeit (asiatische Fähren fahren in der Regel nicht nach Zeitplan sondern wenn sie voll sind) sicher am anderen Flussufer an. Selten war der Kontrast zwischen Tourismus und 'wirklichem' Laos so deutlich wie hier. Auf der einen Seite des Mekongs das pulsierende Weltkulturerbe Luang Prabang mit seinen unzähligen Cafés, Restaurants und Tempeln; und am anderen Ufer stand ich mit meiner Suzuki DL650 inmitten eines winzigen Dorfes auf einer sandigen Dirtroad.
An der Reaktion der Kinder gemessen war bestimmt schon lange kein Westler mehr auf dieser Strasse unterwegs. Sobald sie mein Motorrad auch nur von weitem erahnen konnten, rannten sämtliche Dorfkinder aus ihren Häusern, um mich freudig winkend mit einem „Sabaidee“ zu begrüssen. Bei meiner ersten Flussdurchfahrt ersparte mir diese Begeisterung sogar einiges an Arbeit. Wie immer schnallte ich die Seitenkoffer ab und watete durch den etwa knietiefen Fluss, um die optimale Route auszumachen. Noch während ich etwas unbeholfen in Richtung Ufer stapfte, machten sich die Kinder über meine Alu-Koffer her und trugen sie jeweils zu zweit über den Fluss. Etwa 15 neugierige Augenpaare beobachteten dann gebannt jede meiner Bewegungen, was meine Zuversicht nicht unbedingt steigerte. Glücklicherweise verlief abgesehen von einem kleinen Felsen in der Flussmitte alles nach Plan und ich erreichte sicher das andere Ufer.
Schnell entschloss ich mich, die erste Hälfte der Schulsachen in diesem Dorf zu verteilen, da es einfach perfekt geeignet war: Sehr abgelegen, verhältnismässig arm, viele begeisterte Kinder und eine kleine Grundschule direkt hinter einer kleinen Ansammlung von Hütten. Die anfängliche Zurückhaltung schlug schnell in Euphorie um, als die Kinder realisierten, dass ich ihnen die vielen bunten Pakete schenken würde. Sie begleiteten mich aufgeregt zur Schule, wo ich ein etwas älteres Mädchen beauftragte, die Schulutensilien gerecht zu verteilen. Als ich einige Minuten später fertig angezogen zum Abschied den Kindern zuwinke, sah ich, dass jedes von ihnen stolz ein Heft und Stifte in der Hand hält und mir dankbar zulächelt. Diesen Dank möchte ich gerne an Rainer Wolf von R.S. Wolf in Lampertheim weiterreichen, der mir durch seine Spende dieses tolle Erlebnis erst ermöglicht hat.

Nach diesem Dorf wurde der auf meiner Landkarte als befestigte Hauptstrasse gekennzeichnete Weg immer haarsträubender. Flussdurchfahrten, extrem steile Anstiege sowie Abfahrten und zunehmend tiefer Sand. Ich kann wirklich mit jedem Untergrund leben; Lehm, Staub, Schotter und oberflächlicher Sand sind mir oft sogar lieber als Asphalt. Tiefer Sand auf steilen Abfahrten hingegen definitiv nicht. Vergeblich versuchte ich im ersten Gang mit durchgedrückter Hinterradbremse den tiefen (oft vom Sand verborgenen) Spurrinnen der LKWs auszuweichen, musste mich aber dennoch der Schwerkraft geschlagen geben. Die atemberaubend schöne Landschaft konnte ich bei diesen Strassenbedingungen leider nicht geniessen. Jeder Funken Konzentration galt den nächsten 100 Metern, die ich mich weiter in Richtung Pak Beng vorkämpfte. Schnell zeichnete sich jedoch ab, dass ich mein Tagesziel nicht erreichen würde und so suchte ich ab ca. 17 Uhr nach einem Dorf, in dem ich übernachten konnte. Bei schon untergehender Sonne erspähte ich gegen 17.30 Uhr eine grössere Ansammlung von Hütten und hielt von Kopf bis Fuss staubig und verschwitzt vor einer Tankstelle (= zwei Benzinfässer) an. Mit Händen und Füssen erklärte ich dem etwas verdutzten Tankwart mein Problem, der mich freudestrahlend zu seinem Haus führte. Dort gab es einen grossen Gemeinschaftsraum, in dem ich auf einigen Reisstrohmatten schlafen durfte. Auf meinem Weg zur 'Dusche' (= Fluss) teilten ein paar Bauarbeiter ihr Abendessen mit mir und schenkten mir einen Lao Lao (Reisschnaps) nach dem anderen ein. Überglücklich über so viel Gastfreundschaft versorgte ich am Abend die im Gemeinschaftsraum vor dem TV versammelten Kinder mit Wassermelone und Chips und meine Gastgeber mit ausreichend Beerlao. Eine super Erfahrung!
Nach einer kalten Nacht verabschiedete ich mich von der netten Familie und nahm erneut den Kampf mit der Dirtroad nach Pak Beng auf. Diese zweite Runde gestaltete ich nach nur 1,5 Stunden siegreich durch technischen KO: Die Dirtroad wurde zu einer wunderbar asphaltierten Strasse, die mich bis nach Pak Beng und sogar noch 150 km weiter nach Oudomxai führte. Das einzig verbleibende Hindernis war eine sehr klapprige Fähre, deren Auffahrrampe lediglich ein paar flüchtig zusammengenagelte Bretter waren. Der Einstieg verlief noch recht problemlos, die Abfahrt am anderen Ufer hingegen war abenteuerlich. Jetzt musste ich praktisch ohne Anlauf leicht bergauf die Schwelle zum Steg überwinden, etwa einen Meter zwischen Boot und Land überbrücken und dann den sandigen Anstieg zur Strasse meistern. Nach einigem Zögern und zwei Versuchen, fasste ich mir ein Herz, gab Gas und erreichte adrenalingeladen den rettenden Asphalt. Genau für diese Momente reise ich mit meiner DL650 durch die Welt. Absolute Freiheit und Unabhängigkeit gepaart mit endlosen Abenteuern. Bitte mehr davon!
Hunde und Schweine sieht man sogar noch häufiger – insbesondere in Nordlaos. Gerade Jungtiere sind oft unberechenbar und haben mich schon zu der ein oder anderen Vollbremsung gezwungen. Natürliche Selektion sorgt letztlich dafür, dass nur die vernünftigsten Tiere ein fortgeschrittenes Alter erreichen, weshalb ausgewachsene Schweine und Hunde kein Grund zur Besorgnis sind. Hühner, Gänse und Enten rennen überraschenderweise kopflos wie Hühner auf der Strasse herum; was genau sie vorhaben wissen wohl nur sie selbst. Allerdings lassen sie sich durch beherztes Hupen verscheuchen, was ihr Gefahrenpotential doch deutlich reduziert.
Touristen auf Rollern trifft man glücklicherweise nur an wenigen Orten an – Luang Prabang ist einer davon. Bei ihrem Fahrstil scheinen sie mit dem fahrbaren Untersatz gleichzeitig eine Aura der Unverwundbarkeit gemietet zu haben. Flip-Flops, T-Shirt, kurze Hosen und eine Extraportion Optimismus erfüllen ihr Sicherheitsbedürfnis. Blauäugig nehmen viele an, es gäbe keine Verkehrsregeln und missachten so die deutlich subtileren Verhaltensweisen auf asiatischen Strassen (z.B. ein Mal hupen = ich bin hinter dir, fahr genau so weiter; zwei Mal hupen = ich möchte überholen, fahr rechts ran; drei Mal hupen = du machst etwas grundlegend falsch...). Sie sind nicht nur unberechenbar, sondern reagieren auch noch meistens falsch auf die Hupsignale. So werden sie zu einer echten Gefahrenquelle, über die sich selbst die sonst so geduldigen Laoten mit Inbrunst aufregen. Hier hilft nur eins: Bremsen, sehr viel Abstand halten beim Überholen und so schnell wie möglich die Touristenregion verlassen.

Genau das machte ich zwei Tage später als ich Pak Beng, eine kleine Stadt nahe der thailändischen Grenze ansteuerte. Rainer Wolf von R.S. Wolf in Lampertheim war so grosszügig, mir Geld für Schulsachen zu geben, die ich in abgelegenen Dörfern verteilen sollte. Und so machte ich mich mit gefühlt 10 Kilogramm Heften, Bleistiften, Buntstiften, Linealen, Kulis, Radiergummis und Spitzern auf die Suche nach der Fährstation über den Mekong. Schnell wurde ich fündig und setzte nach einer kurzen Wartezeit (asiatische Fähren fahren in der Regel nicht nach Zeitplan sondern wenn sie voll sind) sicher am anderen Flussufer an. Selten war der Kontrast zwischen Tourismus und 'wirklichem' Laos so deutlich wie hier. Auf der einen Seite des Mekongs das pulsierende Weltkulturerbe Luang Prabang mit seinen unzähligen Cafés, Restaurants und Tempeln; und am anderen Ufer stand ich mit meiner Suzuki DL650 inmitten eines winzigen Dorfes auf einer sandigen Dirtroad.
An der Reaktion der Kinder gemessen war bestimmt schon lange kein Westler mehr auf dieser Strasse unterwegs. Sobald sie mein Motorrad auch nur von weitem erahnen konnten, rannten sämtliche Dorfkinder aus ihren Häusern, um mich freudig winkend mit einem „Sabaidee“ zu begrüssen. Bei meiner ersten Flussdurchfahrt ersparte mir diese Begeisterung sogar einiges an Arbeit. Wie immer schnallte ich die Seitenkoffer ab und watete durch den etwa knietiefen Fluss, um die optimale Route auszumachen. Noch während ich etwas unbeholfen in Richtung Ufer stapfte, machten sich die Kinder über meine Alu-Koffer her und trugen sie jeweils zu zweit über den Fluss. Etwa 15 neugierige Augenpaare beobachteten dann gebannt jede meiner Bewegungen, was meine Zuversicht nicht unbedingt steigerte. Glücklicherweise verlief abgesehen von einem kleinen Felsen in der Flussmitte alles nach Plan und ich erreichte sicher das andere Ufer.
Schnell entschloss ich mich, die erste Hälfte der Schulsachen in diesem Dorf zu verteilen, da es einfach perfekt geeignet war: Sehr abgelegen, verhältnismässig arm, viele begeisterte Kinder und eine kleine Grundschule direkt hinter einer kleinen Ansammlung von Hütten. Die anfängliche Zurückhaltung schlug schnell in Euphorie um, als die Kinder realisierten, dass ich ihnen die vielen bunten Pakete schenken würde. Sie begleiteten mich aufgeregt zur Schule, wo ich ein etwas älteres Mädchen beauftragte, die Schulutensilien gerecht zu verteilen. Als ich einige Minuten später fertig angezogen zum Abschied den Kindern zuwinke, sah ich, dass jedes von ihnen stolz ein Heft und Stifte in der Hand hält und mir dankbar zulächelt. Diesen Dank möchte ich gerne an Rainer Wolf von R.S. Wolf in Lampertheim weiterreichen, der mir durch seine Spende dieses tolle Erlebnis erst ermöglicht hat.
Nach diesem Dorf wurde der auf meiner Landkarte als befestigte Hauptstrasse gekennzeichnete Weg immer haarsträubender. Flussdurchfahrten, extrem steile Anstiege sowie Abfahrten und zunehmend tiefer Sand. Ich kann wirklich mit jedem Untergrund leben; Lehm, Staub, Schotter und oberflächlicher Sand sind mir oft sogar lieber als Asphalt. Tiefer Sand auf steilen Abfahrten hingegen definitiv nicht. Vergeblich versuchte ich im ersten Gang mit durchgedrückter Hinterradbremse den tiefen (oft vom Sand verborgenen) Spurrinnen der LKWs auszuweichen, musste mich aber dennoch der Schwerkraft geschlagen geben. Die atemberaubend schöne Landschaft konnte ich bei diesen Strassenbedingungen leider nicht geniessen. Jeder Funken Konzentration galt den nächsten 100 Metern, die ich mich weiter in Richtung Pak Beng vorkämpfte. Schnell zeichnete sich jedoch ab, dass ich mein Tagesziel nicht erreichen würde und so suchte ich ab ca. 17 Uhr nach einem Dorf, in dem ich übernachten konnte. Bei schon untergehender Sonne erspähte ich gegen 17.30 Uhr eine grössere Ansammlung von Hütten und hielt von Kopf bis Fuss staubig und verschwitzt vor einer Tankstelle (= zwei Benzinfässer) an. Mit Händen und Füssen erklärte ich dem etwas verdutzten Tankwart mein Problem, der mich freudestrahlend zu seinem Haus führte. Dort gab es einen grossen Gemeinschaftsraum, in dem ich auf einigen Reisstrohmatten schlafen durfte. Auf meinem Weg zur 'Dusche' (= Fluss) teilten ein paar Bauarbeiter ihr Abendessen mit mir und schenkten mir einen Lao Lao (Reisschnaps) nach dem anderen ein. Überglücklich über so viel Gastfreundschaft versorgte ich am Abend die im Gemeinschaftsraum vor dem TV versammelten Kinder mit Wassermelone und Chips und meine Gastgeber mit ausreichend Beerlao. Eine super Erfahrung!
Nach einer kalten Nacht verabschiedete ich mich von der netten Familie und nahm erneut den Kampf mit der Dirtroad nach Pak Beng auf. Diese zweite Runde gestaltete ich nach nur 1,5 Stunden siegreich durch technischen KO: Die Dirtroad wurde zu einer wunderbar asphaltierten Strasse, die mich bis nach Pak Beng und sogar noch 150 km weiter nach Oudomxai führte. Das einzig verbleibende Hindernis war eine sehr klapprige Fähre, deren Auffahrrampe lediglich ein paar flüchtig zusammengenagelte Bretter waren. Der Einstieg verlief noch recht problemlos, die Abfahrt am anderen Ufer hingegen war abenteuerlich. Jetzt musste ich praktisch ohne Anlauf leicht bergauf die Schwelle zum Steg überwinden, etwa einen Meter zwischen Boot und Land überbrücken und dann den sandigen Anstieg zur Strasse meistern. Nach einigem Zögern und zwei Versuchen, fasste ich mir ein Herz, gab Gas und erreichte adrenalingeladen den rettenden Asphalt. Genau für diese Momente reise ich mit meiner DL650 durch die Welt. Absolute Freiheit und Unabhängigkeit gepaart mit endlosen Abenteuern. Bitte mehr davon!
4. März 2013
Eine Krise als Chance auffassen. Gerne wird diese bedeutungsarme Satzhülle mit dem Verweis auf vermeintlich identische chinesische Schriftzeichen untermauert. In der Praxis dient der Ausspruch nur zu oft als Rechtfertigung, um nach gravierenden Fehlern an seinem Posten festzuhalten. In Laos hingegen nähern sich die beiden Konzepte tatsächlich bemerkenswert an, wie ich in meinen ersten zehn Tagen eindrucksvoll erleben durfte.
Nach den fast übermenschlichen Anstrengungen des Attapeu-Trails (beschrieben im letzten Blogeintrag) fuhr ich gleich am nächsten Tag in das idyllisch am Wasserfall Tad Lo gelegene Dorf Sen Vang. Dort war ich bereits vor einem Jahr, brach allerdings nach nur einer Nacht entnervt von den Touristenmassen wieder auf. Dieses Mal kehrte ich nur zurück, da ich von einem Österreicher gehört habe, der den erstklassigen Kaffee des benachbarten Bolaven-Plateaus nach äthiopischer Tradition täglich frisch röstet. Ein absolutes Highlight für einen Kaffeeliebhaber wie mich. Schnell hatte ich Emmanuel (kurz 'M') gefunden und stellte zu meiner Überraschung fest, dass sich viel weniger Touristen als letztes Jahr im Dorf aufhielten. M hat mit der laotischen Regierung einen Vertrag geschlossen, der ihm ein beträchtliches Grundstück miet- und steuerfrei zusichert, solange er den Dorfkindern in einer kleinen Schule englisch beibringt.
Was für ein Zufall! Hätte ich keine Sponsoren für meine Motorradtour gefunden, hätte ich acht Monate als Englischlehrer in einem kleinen laotischen Dorf gelebt. Glücklich über die Chance, nun beide Dinge verbinden zu können, unterstützte ich den allabendlichen Unterricht nach Kräften, verteilte einige Stifte, die mir Suzuki mitgegeben hatte und übte auch in der Freizeit mit den Dorfkindern die wenigen Brocken Englisch, die sie beherrschten. Im Gegenzug brachten sie mir nicht nur etwas Laotisch bei, sondern nahmen mich dankbar in ihre Dorfgemeinschaft auf. Wann immer ich (respektvoll “Teacher Steven“ genannt) durch die Dorfstrassen schlenderte, begrüssten mich Schüler und nutzten die Gelegenheit, um ihr Englisch zu verbessern. Wir spulten die eingeübten Begrüssungsfloskeln ab und vorsichtig versuchte ich, ihnen im Dialog das ein oder andere neue Wort beizubringen – jedes Mal von einem Glücksgefühl begleitet, wenn sie es am nächsten Tag noch wussten.
Am zweiten Abend musste ich den Dschungelstrapazen leider Tribut zollen. Nach einer Einladung zum Abendessen sowie zum anschliessenden Reisfest im Tempel bekam ich hohes Fieber und musste die nächsten zwei Tage weitestgehend in meinem Bungalow verbringen. Alle weiteren Reisepläne waren auf Eis gelegt, bis ich mich wieder vollends erholt hatte. Asiatische Strassen bieten schier grenzenlose Abenteuer, erfordern aber auch ein Höchstmass an Konzentration, um später davon erzählen zu können. Geschwächt durch Fieber ist auch nur eine kurze Tagesetappe undenkbar.

Ich bin nie krank; ich hasse es, krank zu sein. Wenn ich denn mal krank bin, bemitleide ich mich rund um die Uhr und hadere mit meinem bedauernswerten Schicksal. Nicht so in Sen Vang. Nachdem das Fieber nach zwei Tagen halbwegs unter Kontrolle war, genoss ich die friedliche Dorfatmosphäre, verbrachte viel Zeit mit den Einheimischen und gab mein Bestes, um den Kindern etwas Englisch beizubringen. Glücklich über mein Fieber verbrachte ich fast eine Woche in Sen Vang, beobachtete den Dorfalltag und fragte mich, warum die Menschen (gerade die Kinder) nur so zufrieden sind. Die Gedanken des letzten Jahres kamen wieder hoch: Was macht sie so glücklich? Was braucht man wirklich, um glücklich zu sein? Zeige ich ihnen, was sie nie haben werden und zerstöre so einen Teil ihrer Welt?
Schwierige Fragen, zu denen ich immer noch keine adäquaten Antworten gefunden habe. Bevor mich meine Gedanken vollends lähmten, verabschiedete ich mich von allen Kindern und machte mich auf den Weg nach Nahin. Eigentlich wollte ich die gut 550 Kilometer auf kleinen Offroadpisten zurücklegen, entschied mich mit Blick auf meine gerade überstandene Fiebererkrankung doch für die langweilige Route 9: 550 Kilometer schnurgeradeaus durch staubige, unbarmherzige Hitze. Ironischerweise erlebte ich dennoch beim Abladen meines Gepäcks einen Rückschlag, hatte plötzlich extrem hohes Fieber und konnte mich kaum auf den Beinen halten. 17 Stunden Schlaf und einige Ibuprophen später sass ich im Wartezimmer eines kleinen Arztes. Ich wusste nicht wirklich wie vertrauenswürdig die Praxis war, da sie gleichzeitig Bäckerei, Restaurant und Tante-Emma-Laden war.

Zumindest konnte ich mir die Wartezeit mit Shrimp-Chips und frischem Baguette versüssen. Nur wenige Minuten später bat mich ein freundlicher Bäckermeister/Ladenbesitzer/Koch/Arzt in sein Behandlungszimmer, führte einen Malaria Schnelltest durch und stellte fest, dass ich trotz mehrerer Ibuprohen noch 39,2° Fieber hatte. Am Abend davor müssen es deutlich über 40° gewesen sein. Der Schnelltest ist glücklicherweise negativ, sodass mir der Arzt Paracetamol-Tabletten sowie eine Paracetamol-Spritze verschreibt, über die ich alles andere als glücklich bin. In Indonesien habe ich haarsträubende Hygienestandards in Krankenhäusern erlebt und bat den Doktor recht unumwunden, mir die Nadeln zu zeigen. Als ich die Originalverpackung sah, willigte ich erleichtert ein und versuchte den etwas pikierten Arzt augenzwinkernd mit einem Hinweis auf meine deutsche Ordnungswut zu besänftigen.
Erfolgreich offensichtlich, da er mir anbot, später seinen Laptop nutzen zu dürfen, um ein paar Emails zu schicken. Nach einigen Stunden Schlaf fühlte ich mich schon viel besser und suchte gestärkt die Praxis meines neu gewonnen Freundes auf, die direkt an sein Privathaus grenzte. Noch bevor ich seinen Laoptop überhaupt öffnen konnte, lud er mich ein, mit seiner gesamten Familie ein typisch laotisches Abendessen zu geniessen. Leider hielt sich mein Appetit noch stark in Grenzen, sodass ich nur eine Höflichkeitsportion jedes der sechs Gerichte probieren konnte. Wir unterhielten uns über meine Reise, scherzten und verstanden uns blendend – genau für diese Momente fahre ich um die Welt.
Krise oder Chance?
Ohne mein Fieber hätte ich Sen Vang nach einem oder zwei Tagen verlassen, hätte nicht in der kleinen Schule unterrichtet, wäre nicht liebevoll in die Dorfgemeinschaft aufgenommen worden, hätte nicht mit Familien gegessen und hätte das Reisfest nicht erlebt. Nie hätte ich auch nur einen Fuss in die Multifunktions-Praxis gesetzt und hätte auch hier den wertvollen Einblick in die laotische Kultur verpasst. Als ich mit der Familie meines Arztes ein üppiges Festmahl geniesse, muss ich über mein zynisches Weltbild schmunzeln. Krise als Chance – in Laos ist das durchaus mehr als nur eine leere Satzhülse. Vielleicht ist es sogar ein möglicher Erklärungsansatz für die zahlreichen Fragen, die mir noch immer unbeantwortet durch den Kopf gehen.
Bis zur nächsten Krise verbleibe ich mit abenteuerlichen Grüssen!
26. Februar 2013
Nach gerade mal 10 Minuten war ich samt Motorrad durch die kambodschanisch-laotische Grenze ohne auch nur einen USD Schmiergeld gezahlt zu haben. Ein überraschend unproblematischer Start meiner Reise in die Vergangenheit. Vor einem Jahr kaufte ich mir in der laotischen Hauptstadt Vientiane ein kleines Motorrad und fuhr zwei Monate lang ca. 5.000 km durch das gesamte Land. Während dieser Zeit habe ich meine Begeisterung für diese Form des Reisens entdeckt und auch erste Pläne geschmiedet für den Road Trip, auf dem ich mich jetzt befinde.
Wie könnte ein Laosbesuch anders beginnen als mit einer heissen Schüssel Phoe, einer eigentlich vietnamesischen Nudelsuppe, die sich aber mittlerweile in ganz Südostasien als Frühstück durchgesetzt hat. Eine herrlich duftende Hühnerbrühe mit weisslich-glasigen Reisnudeln und Schwein oder Hühnchen. Dazu einen Korb frischer Minze und Salatblätter sowie die schier unendlichen Würzoptionen: Limone, Zucker, Chili, Salz, Pfeffer, Shrimpsauce, Fishsauce, Maggi, Chilipaste... Wie so oft sammelt sich schnell die gesamte Familie der Suppenköchkin, um mir beim Essen zuzusehen und mir gefühlt alle fünf Sekunden ein „Sabaidee“ (Hallo) zuzurufen. Ich liebe dieses Land!
Am nächsten Morgen verliess ich Pakse noch vor 8 Uhr, um eine alternative Offroad-Route ins ca. 120 km entfernte Attapeu zu erkunden. Meine Informationslage zu dieser Strecke war denkbar dünn: „Keine Brücken; nur in der Trockenzeit fahrbar“ (Strassenkarte) und „It's doable, I think“ (englischer Motorradfahrer); mehr wusste ich nicht. Wie gewöhnlich packte ich eine 1,5 Liter Flasche Wasser ein und bog nach ca. 45 km links ab in eine gut ausgebaute Dirtroad. Doch schon nach etwa fünf Kilometern kündigte sich das drohende Unheil an: Die Strasse wurde immer schmaler und bestand praktisch nur noch aus Schlaglöchern, Sand und grossen Felsplatten. Nach gut 15 Kilometern war der Dschungel in Sichtweite und ich legte eine letzte kurze Trinkpause direkt vor einem Schulhof ein.
Wie erhofft kamen sofort alle Kinder zur Strasse gerannt, um das grosse Motorrad und den schwitzenden „Falang“ (Westler) zu bestaunen. Natürlich wollte ich Fotos von den neugierigen Kindern schiessen, was allerdings in Laos etwas kompliziert ist. Kinder sind sehr fotoscheu und müssen mit viel Fingerspitzengefühl überzeugt werden. Ich machte also erst ein Foto aus ca. 10 Meter Entfernung, worauf die Hälfte der Kinder wegrannte. Dann kniete ich mich zu den verbleibenden Kindern und zeigte ihnen den Bildschirm. In laotischen Haushalten gibt es in der Regel keine Spiegel, weshalb die Kinder jede Gelegenheit dankend annehmen, sich und ihre Freunde betrachten zu können. Sofort brach Begeisterung aus und binnen Sekunden umringten mich mehr als 20 Kinder, die alle ein Foto mit mir machen wollten. Eine Viertelstunde später beendete der Schulgong die zunehmend chaotische Situation und ich schwang mich wieder auf meine DL650 ohne zu ahnen, dass mich die folgenden 50 Kilometer an meine Grenzen – und darüber hinaus – bringen würden.
Schon bald erwartete mich eine erste tückische Flussdurchfahrt. Die optimale Spur war zwar nicht sonderlich tief, führte aber über grosse, unebene Felsen, die für mein schweres Motorrad schlichtweg nicht passierbar waren. So musste ich immer wieder Alternativrouten suchen, bis ich nach gut zehn Minuten endlich das rettende Ufer erreicht hatte. Nun begann der härteste Abschnitt: Die Dirtroad führte immer tiefer in den Dschungel und war nach wenigen Kilometern kaum noch zwei Meter breit. Etwa alle 20 Minuten führte der Pfad hinab in ein felsiges, weitgehend ausgetrockenetes (=knietiefes) Flussbett, das es zu durchqueren galt. Das Schwierige war meistens nicht der Fluss selbst, sondern der steile Anstieg auf der anderen Seite, der mit matschigen Reifen zur echten Herausforderung wurde. Ein ums andere Mal zog ich den Kürzeren und musste die vollbepackte Suzuki mitten in der Steigung aufrichten – echte Knochenarbeit.
Belohnt – und zugleich relativiert - wurde die Schinderei durch sehr intime Einblicke in das harte Leben der laotischen Landbevölkerung. In winzigen Dörfern leben mehrere Grossfamilien oft ohne Strom und Wasserversorgung fernab von Schulen und Krankenhäusern. Der extrem beschwerliche Weg zur nächsten Stadt zwingt die Menschen, so weit wie möglich autark zu leben. Das betrifft primär sicherlich die Ernährung, berührt aber auch andere Bereiche wie etwa die Freizeitgestaltung. Selten wurde ich derart begeistert in Dörfern empfangen wie an diesem Tag.

Zum Teil kamen Kinder aus über hundert Meter Entfernung angesprintet, nur um mir freudestrahlend zuzuwinken und „Sabaidee“ (Hallo) zurufen zu können. Auch für die Dorfältesten war ich eine willkommene Abwechslung. Oft fragten sie mich auf laotisch, wohin ich fahre. Wenig überraschend nach Attapeu – der Pfad führte ausschliesslich in diese Stadt; Kreuzungen oder Gabelungen gab es schlichtweg nicht. Nach dieser Auskunft berieten sich die Männer zumeist kurz, um mir dann stolz den Weg zu weisen (exakt weiter in Fahrtrichtung). Diese Farce kostete mich zwar jedes Mal wertvolle Zeit, ich konnte die Dorfbewohner aber nur zu gut verstehen. Und so lächelte ich geduldig, rief ihnen „Khob Jai Lei Lei“ (Vielen Dank) entgegen und verbeugte mich leicht, bevor ich meine Reise fortführte.
Nach etwa einem Drittel des Weges erwartete mich ein schier unüberwindbares Hindernis. Am Ende des typischen steilen Abhangs zum Flussbett warteten bereits acht Kinder am Ufer, was nur eines bedeuten kann: Ein sehr tiefer Fluss, durch den man sein Motorrad tragen (lassen) muss. Bei einer ersten flüchtigen Flussbegehung stellte ich ernüchtert fest, dass mir das Wasser fast bis zur Hüfte reichte und dass die Strömung ausgerechnet an der tiefsten Stelle recht stark war. Zielsicher watete ich durch den Fluss auf die Kinder zu und erkundigte mich nach ihren Preisvorstellungen. Fast schon belustigt beobachtete ich, wie sie eine Null nach der anderen in den Sand malten – 200.000 Kip (20 Euro).
Lächerlich teuer! Ich bot ihnen einen Euro mit dem Hintergedanken, nicht mehr als fünf Euro zu zahlen. Zu meinem Erstaunen lehnten sie jedes meiner Angebote ab und forderten immer noch utopische zehn Euro. Ich spielte alle in Bangkok erlernten Verhandlungstricks aus: Weggehen, lachend einige Nullen wegstreichen, mit Geld herumwedeln, wegfahren, den Fluss mehrfach abgehen... Nichts half. Leicht genervt begann ich sämtliches Gepäck abzunehmen, zog meine Jacke aus und bot den Kindern ein letztes Mal fünf Euro an. Als sie auch dieses Angebot ablehnten, ging ich nochmals die ideale Spur durch den Fluss ab und markierte alle grösseren Felsen mit Bambusrohren. Ich legte den ersten Gang ein und begann, meine geliebte Suzuki mit konstant hoher Drehzahl durch den Fluss zu schieben. Gebannt beobachteten mich die Kinder vom Ufer aus und auch ich selbst konnte meine Anspannung und Ungewissheit nur unzureichend verbergen. Wenn ich meine Suzuki schon zerstören muss, dann doch bitte in einem echten James-Bond-Moment mit 120 km/h, viel Feuer und einem lauten Knall. Aber doch nicht in einem Fluss mitten im laotischen Dschungel vor den schadenfrohen Augen einiger Halbstarker.
An der tiefsten Stelle muss ich mich mit meinem gesamten Körpergewicht gegen die Strömung legen und schaffte es glücklicherweise mit Vollgas und vorsichtigem Kupplungsspiel bis ans so sehr herbeigesehnte Ufer. Mit vor Stolz geschwellter Brust marschierte ich mit einem 50.000 Kip Schein in der Hand durch den Fluss, steckte ihn vor den Augen der verdutzt blickenden Kinder in meinen Geldbeutel und brachte mit letzter Kraft mein Gepäck wieder am Motorrad an. Es sollte das letzte Hochgefühl für eine lange Zeit werden.
Der absoluten Erschöpfung nahe, musste ich mich mehrfach 20 Minuten im Schatten ausruhen, um mit neuen Kräften meine Suzuki wieder mal in einer Flusssteigung aufzurichten. Das Wasser wurde knapp; meine Beine entwickelten zunehmend ein Eigenleben. Ich war verzweifelt. In den letzten sechs Stunden habe ich gerade mal 40 Kilometer zurückgelegt, es war bereits 15:30 Uhr und von der nächsten asphaltierten Strasse trennten mich noch etwa 45 Kilometer. Wie soll ich das nur schaffen? Wo werde ich schlafen? Was werde ich essen/trinken?
Diese wenig hilfreichen Gedanken wurden plötzlich von ausgelassenem Kinderlachen unterbrochen. Sofort sprang ich zurück auf meine Maschine, fuhr in Richtung der Kinder und stand nur zwei Minuten später in einem vielversprechenden Dorf. Es war mehr als doppelt so gross wie alle Dörfer davor, hatte Strom, halbwegs ausgebaute Dirtroads und sogar ein kleines Restaurant. Als ich gerade die erste Flasche Wasser geleert hatte, fährt aus der Gegenrichtung plötzlich ein Deutscher auf einer Honda Transalp vor - ich konnte es nicht fassen.
„Wo kommst du her?“ fragte ich Jens. „Aus Attapeu.“
„Wie weit ist es bis da?“ - „40 Kilometer ca.“
„Wie ist die Strasse? Wie lange hast du gebraucht für die Strecke?“ - „Super Dirtroad, in etwa einer Stunde bist du da.“
Danke, danke, danke! Noch nie habe ich mich derart darüber gefreut, einen Deutschen im Urlaub zu treffen. Vielleicht habe ich mich noch nie so gefreut, irgendjemanden irgendwo zu treffen. Ich war gerettet! Meine Schauergeschichten überzeugten Jens und seine Freundin Sylwia letztlich umzukehren und die Strecke am nächsten Tag in Angriff zu nehmen. So fuhren wir zu dritt die gut 40 Kilometer und standen nur eine gute Stunde später mit einem grossen Beerlao (das laotische Bier schlechthin) in der Hoteleinfahrt. Prost!
18. Feburar 2013
„Warum machst du das bloss alleine? Kannst du nicht noch einen zweiten Verrückten finden? Bist du dann nicht einsam?“
So ähnlich lautete die wohl meistgestellte Frage an mich im Vorlauf meiner Reise. Für Menschen, die noch nie durch Asien gereist sind, ist es nur schwer vorstellbar, dass Einsamkeit dort ein Ding der Unmöglichkeit ist. Man trifft einfach überall Einheimische, andere Reisende oder Auswanderer, mit denen man gemeinsam Zeit verbringt. Gerade als Alleinreisender wird man besonders oft angesprochen und hat dadurch ironischerweise sogar mehr soziale Kontakte als Gruppenreisende. In Kambodscha zeigte sich dieses Phänomen durchgehend:
In Bangkok verliess ich nach vier tollen Tagen mit alten Freunden den Sivalai Place und machte mich auf in Richtung Kambodscha. Meinen letzten Stopp in Thailand machte ich in der Nähe von Klaeng (Rayong), wo mich die Eltern einer guten Freundin zu sich nach Hause eingeladen haben. Sie holten mich in Klaeng ab, zeigten mir den Essensmarkt und kauften einige lokale Spezialitäten, die wir am Abend mit der gesamtem Familie geniessen würden: Hähnchen, Rochen, Shrimps, Mango mit Klebreis, Desserts... Das gemeinsame Abendessen war dann auch überraschend lustig. Einige Familienmitglieder konnten etwas englisch sprechen und zusammen mit meinen Thaikenntnissen, Händen, Füssen und reichlich Wein verstanden wir uns bestens. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von der Familie und setzte meinen Weg nach Kambodscha fort.

An der Grenze angekommen bemerkte ich eine 200cc Lifan und traf nur wenige Meter weiter am Zollhäuschen Heinz, den deutschen Besitzer der Maschine. Er ist ca. Mitte 50 hat schon fast überall in der Welt gelebt und wohnt derzeit in Chiang Mai (Thailand). Wir verstehen uns auf Anhieb und beschliessen, die Fahrt nach Sihanoukville gemeinsam in Angriff zu nehmen. Da wir uns beide nicht wirklich über die Stadt informiert haben, landen wir am völlig verlassenen Ende von Sihanoukville und checken im äusserst verlockend klingenden Snake-Guesthouse ein. Nach einer Dusche stehen wir unten im Hof bei den Maschinen und sind etwas ratlos, wie wir in dieser Geisterstadt den Abend verbringen sollen. In diesem Moment kommen Roman, Jana und Daniel, eine russische Familie auf uns zu und Roman sagt freudestrahlend: „Wenn ihr bei irgendetwas Hilfe braucht, sagt mir Bescheid! Ich helfe euch sehr gerne!“
Fantastisch! Heinz sucht eine Tankstelle, ich einen Geldautomat und wir beide ein gutes Restaurant. Kaum ist unser Wunsch ausgesprochen, schwingt sich Roman auf seinen Roller und führt uns die ca. fünf Kilometer ins Stadtzentrum. Vollgetankt und mit frischem Geld ausgestattet sitzen Heinz und ich nur wenig später überglücklich vor einem riesigen Grillteller in einer Strandbar und schmieden Pläne für den nächsten Tag. Als wir gegen 22:00 Uhr den Rückweg antreten möchten, finde ich an meiner Navihalterung einen Zettel. Mein erster Gedanke war „Mist, Strafzettel“, aber die gibt es glücklicherweise in Kambodscha nicht. Jana und Harold, zwei Deutsche, die exakt meine Route in umgekehrter Richtung gefahren sind, haben mir eine kleine Karte zu ihrem Guesthouse gemalt und mich auf ein Bier eingeladen. Sofort schmeisse ich alle Planungen für den nächsten Tag über Bord und fahre mit Heinz zum Panda Guesthouse, in dem uns Jana und Harold gleich herzlich in Empfang nehmen.

Die nächsten zwei Stunden tauschen wir haarsträubende Anekdoten aus, wie sie nur Motorradreisende erleben können, fachsimpeln über unsere Maschinen und stimmen unsere weiteren Routen etwas ab. Die beiden sind sehr nett und lustig und können mir dazu noch wertvolle Tipps für meine weitere Reise geben. Daher beschliesse ich, noch einen Tag in Sihanoukville zu bleiben, während Heinz schon weiter Richtung Phnom Penh fährt – eine sehr gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Praktisch den gesamten Tag frage ich Jana und Harold Löcher über ihre Erfahrungen in den Bauch; insbesondere über das Stück in Pakistan. Beide bestätigen meine Einschätzung, dass es unbedenklich ist, geben mir aber dennoch einige Kontakte, die sich sehr gut auskennen und die aktuelle Sicherheitslage gut bewerten können. Lustigerweise sind Jana und Harold auch auf Suzuki V-Stroms unterwegs und hatten auf ihren 25.000 km nicht eine einzige Panne - nicht mal einen Platten. Hoffen wir, dass ich auch so viel Glück habe.
Am nächsten Morgen schwinge ich mich wieder auf meine DL650, um die gut 300 Kilometer entfernte Hauptstadt Phnom Penh anzusteuern. Der Verkehr dort ist vorsichtig ausgedrückt wahnsinnig. In einem Anflug absoluter Anarchie fahren Autos, Busse, LKWs und endlos viele Mopeds kreuz und quer über rote Ampeln, Fusswege etc. Absolut verrückt! Dagegen ist Bangkok ein Vorbild an Ordnungsliebe. Nach etwa einer Stunde im dichten Stadtverkehr erreichte ich die Hotel- und Barstrasse direkt am Mekong und konnte meinen Augen kaum trauen: Vor einem kleinen Hotel stand eine orangefarbene 200cc Lifan – ich habe Heinz wiedergefunden in der zwei Millionen Metropole.

Da ich meist deutlich früher ins Bett gehe als Heinz, verabschiedete ich mich kurz nach unserem gemeinsamen Abendessen und machte mich am nächsten Morgen zeitig auf die Suche nach einem typisch kambodschanischen Frühstück. Nur wenige Strassen weiter traf ich die drei unfehlbaren Anzeichen eines guten Restaurants an: Es war dreckig, laut und man sass auf Plastikstühlen. Wie in fast ganz Südostasien wurde auch an diesem Stand eine herrlich duftende Nudelsuppe mit Fleisch und allerlei Würzmöglichkeiten serviert. Diese sind eigentlich das Wichtigste; es gibt starke und schwache Fischsauce, getrocknete Chilis, Chilipaste, Salz, Pfeffer, Zucker, Limone, Sojasauce... Ganz vertieft in diese Suppen-Alchemie bemerkte ich erst einige Minuten später, dass mich mein Sitznachbar interessiert beobachtete. Er stellte sich mir kurze Zeit später als Boun Houen vor und wir unterhielten uns daraufhin etwa 1,5 Stunden lang über die Unterschiede zwischen Kambodscha und Deutschland, meine Reise und selbstverständlich Suppe ;)
Am nächsten Tag wollte ich den ersten Service in Phnom Penh durchführen lassen. Dank meiner aussergewöhnlichen Gabe, mich trotz GPS und Landkarte verfahren zu können, verpasste ich allerdings das grosse Suzuki Service-Center und landete in einer winzigen Werkstatt. Dort bot mir Dalin, ein junger Englischlehrer, Hilfe an, führte mich zur Suzukizentrale und übersetzte dort sogar noch für mich. Etwa 45 Minuten später hatte meine DL650 alle Tests mit Bravour bestanden und ich ging mit Dalin Mittagessen. Seine Geschichte ist wirklich beeindruckend. Er wurde als eines von fünf Kindern in eine sehr arme Familie im ländlichen Kambodscha geboren. Da die öffentlichen Schulen nur unzureichende Bildungsmöglichkeiten boten, arbeitete er schon als Kind, um sich so einige Nachmittag an einer Privatschule leisten zu können.
Mit diesem Wissen fand er in Phnom Penh Arbeit als Kellner und zog mit Westlern in eine Wohngemeinschaft, um seine Englischkenntnisse weiter zu verbessern. Heute ist er Englischlehrer an einer Privatschule und wird in den nächsten Jahren an der nationalen Universität lehren.
Wie viel Glück ich doch hatte, in Deutschland geboren worden zu sein. Ohne Gegenleistung erwarb ich mit meiner Geburt das Anrecht auf gute Bildung und bin mir vielleicht gerade deshalb meiner aussergewöhnlichen Situation nur selten bewusst. Dalin ist ebenfalls 23 Jahre alt und mir auch in seiner Art recht ähnlich. So fiel es mir leicht, mich in seine Lage hineinzuversetzen und ich muss leider zugeben, dass ich wohl nicht seinen Kampfgeist gezeigt hätte. Wäre ich – als sonst exakt gleicher Mensch - in Kambodscha geboren, wäre ich heute ein bettelarmer Bauer; nur durch einen anderen Geburtsort bereise ich heute die Welt mit einem guten Schul- und Studienabschluss. Ein ernüchternder Gedanke, der mich hoffentlich immer auf dem Boden halten wird.
Nach einer recht ereignislosen Fahrt nach Siem Reap, der unmittelbar an Angkor Wat grenzenden Stadt, genoss ich gerade mein indisches Abendessen, als mir eine junge blonde Frau auffiel. Sie lächelte unentwegt und war sehr höflich und respektvoll zur Bedienung. Kurzentschlossen sprach ich sie an, ob wir uns ein Tuk-Tuk zu den Tempelanlagen teilen möchten. Zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass Johanna aus Schwaben kommt und in Würzburg (meiner Heimatstadt) Fotografie studiert hat – was für ein Zufall! Wir unterhalten uns einige Zeit über Fotografie und unsere Reisepläne, bevor wir uns entscheiden, den nächsten Tag einfach zu entspannen und erst tags darauf Angkor Wat zu erkunden. Johanna ist sehr nett, intelligent, unkompliziert und lustig; kurzum: Die perfekte Reisebegleitung. Scherzhaft schmiedeten wir schon Pläne, wie wir einen Beiwagen an mein Motorrad schweissen oder eine Tuk-Tuk Anhängerkupplung anbringen können (Entwarnung an Suzuki: Ich habe beide Ideen wieder verworfen ;) ).
Angkor Wat selbst war zwar sehr schön und beeindruckend, konnte aber nicht ganz mit den funkensprühenden Lobeshymnen (Stichwort: Achtes Weltwunder) mithalten. Dennoch war es ein sehr schöner Tag, den wir standesgemäss in der berühmt-berüchtigten Bar Angkor What? ausklingen liessen. Natürlich nur mit maximal zwei Bier, da ich am nächsten Tag nach Laos fahren würde... Laos, meine heimliche Liebe, seit ich im letzten Jahr zwei Monate mit einem Motorrad kreuz und quer durch das bergige Land gefahren bin. Dort habe ich so viel gelernt wie vielleicht nirgendwo sonst in einer solch kurzen Zeitspanne und viele Begegnungen durchlebe ich in Gedanken oder Träumen immer und immer wieder. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlen wird, wenn diese Traumwelt wieder Realität wird. Auf nach Laos!
5. Februar 2013
Vielleicht fragen sich manche von euch, wie bei einem interaktiven Road Trip die Routenplanung funktioniert. In detaillierter Form natürlich gar nicht, da jeder Vorschlag meinen Zeitplan ins Wanken bringen würde. Daher habe ich – wie bei eigentlich allen meinen Reisen – sehr minimalistisch geplant und oft nur eine ungefähre Aufenthaltsdauer sowie grobe Fahrtrichtung festgelegt. Das erlaubt es mir, meine Route an Wetterbedingungen, Hinweise der Einheimischen und nicht zuletzt eure interaktiven Aufgaben anzupassen. Meistens entscheide ich erst am Abend, wie lange ich am nächsten Tag fahren möchte und entwerfe passend dazu mit Garmin BaseCamp eine Route.
Da ich in Malaysia mit durchschnittlich nur 200-300 km recht konservativ unterwegs war, wollte ich in Thailand schon mal für die langen, harten Etappen trainieren, die mich in Laos erwarten würden. Daher beschloss ich, die gut 500 km von Penang (Malaysia) bis Krabi (Thailand) in einem Stück zu fahren. Eine erste Überraschung erwartete mich noch bevor ich überhaupt auf meiner Suzuki sass: Es war dunkel. Bisher gönnte ich mir immer den Luxus, auszuschlafen und dann gemütlich nach ausgiebigem Frühstück aufzubrechen. Daher wusste ich nicht, wann die Sonne aufgeht und stand etwas ernüchtert um 7:00 Uhr fertig angezogen und bepackt in der nächtlichen Ruhe von Georgetown.
Mit den ersten Sonnenstrahlen gegen 7:30 konnte ich dann endlich mein Motorrad anwerfen und kam auf den sehr gut ausgebauten Strassen Malaysias auch gleich rasch voran. Nach nur gut zwei Stunden stand ich schon ca. 20 km vor der thailändischen Grenze, als ich den glorreichen Einfall hatte, auf einem kleinen Feldweg abseits der Strasse einige Bilder und Videos zu machen. In meiner Begeisterung für die tolle Landschaft vergass ich das GPS am Motorrad und habe wohl versehentlich das Parklicht eingeschaltet. Das Ergebnis lässt sich mit zwei Worten zusammenfassen: Batterie leer.

Mir blieb nichts anders übrig, als die knapp 300 km schwere Maschine zum nächsten Haus zu schieben und auf die Hilfsbereitschaft der Einheimischen zu vertrauen. Wie immer wurde dieses Vertrauen mehr als nur belohnt. Nicht nur überbrückte die nette Familie meine Batterie, sondern bot mir auch noch Wasser an und interessierte sich sehr für mein Motorrad und meine Reise. Nach ca. 45 Minuten war ich startklar und verabschiedete mich ausgiebig von allen Familienmitgliedern bevor ich meine Reise fortsetzte.
Diese Begegnung mag klein erscheinen, sie verdeutlicht aber trotzdem, warum ich die südostasiatische Kultur so bewundere. Es ist kinderleicht mit den Menschen in Kontakt zu kommen und sie auf eine sehr angenehme Art kennenzulernen. Ein Lächeln reichte der Familie schon, um mir ihre Hilfe anzubieten und nach einigen kleineren Gesten des Respekts (z.B. nach dem Namen fragen, leicht verbeugen...) wurde ich ins Haus gebeten und bekam Wasser gereicht. Letztlich freute sich die Familie über die Gelegenheit, mir zu helfen und mit mir Zeit zu verbringen. Dieses Verständnis von Hilfsbereitschaft – Hilfe als Chance und nicht als lästige Pflicht – habe ich erstmals in Indonesien erfahren und versuche es seitdem im Alltag umzusetzen. Leider gelingt es mir noch zu selten.

Die restliche Fahrt verlief ohne Probleme und ich erreichte am späten Nachmittag Krabi, den beliebten Touristen-Umschlagsort im Süden Thailands. Krabis sehr günstige Lage zwischen Phuket, Ao Nang, Koh Phi Phi, Railey Beach und Koh Samui ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil unzählige Durchreisende zwangsläufig das Preisgefüge zerstören; insbesondere die Restaurants in Krabi waren unverhältnismässig teuer bei nur durchschnittlicher Qualität. Zugleich aber ist Krabis Lage ein Segen, da sich bedingt durch die Heerscharen ständig pilgernder Touristen eine Gegenbewegung bildet, die der Hektik entkommen möchte und sich ohne Zeitdruck einige Tage entspannen möchte. Dieser Typus Reisender ist genau nach meinem Geschmack, was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich drei volle Tage in Krabi verbrachte.
Am Morgen nach meiner Ankunft traf ich Rick, einen dieser Reisenden. Er ist ein deutscher IT-Experte, der den Grossteil des Jahres in Melaka (Malaysia) verbringt und mit seinem selbstgebauten Motorrad viele Jahre quer um die Welt gereist ist. Seit unserem ersten Treffen fragte ich Rick Löcher in den Bauch und versuchte, so viel wie irgend möglich von ihm zu lernen. Wie schneide ich zeitsparend Videos? Welche Fahrposition ist offroad kräftesparend? Wie reagiere ich auf plötzlich auftretenden Matsch/Sand? Auf meiner langen Reise werden seine Erfahrungen sicherlich noch von grossem Wert für mich sein. Beim Abschied bietet er mir seine Hilfe in PC-Fragen an, lädt mich in sein Haus nach Melaka ein und sagt einen Satz, der mich jetzt noch zum Schmunzeln bringt: „Wärst du der typische Profi-Abenteurer, hätte ich mich schnell verabschiedet. Erst Dinge, die schief laufen, machen dein Vorhaben interessant.“

Dieses Schmunzeln wäre mir aber am selben Tag fast noch vergangen. Meine nächste Etappe sollte mich auf eintönigen Autobahnen die gut 550 km von Krabi nach Chumphon führen. Autobahn und Abenteuer verträgt sich nur bedingt, weshalb ich den ersten Teil der Route auf kleine Strassen, Feldwege und Dschungeltracks umleitete. Auf den ersten 50-60 km zahlte sich mein Wagemut auch voll aus: Auf winzigen Asphalt- und Dirtroads fuhr ich parallel zur Andaman-Küste, durchquerte abgelegene Dörfer und Dschungelpassagen. Doch dann liess mich mein Glück im Stich. Ein kleiner Trail führte mich durch stetig dichter werdende Vegetation tiefer und tiefer in den Dschungel. Nach ca. vier Kilometern begann ein Labyrinth aus winzigen Wegen, von denen mein GPS nur einen einzigen kannte. Als dieser dann einige hundert Meter später im Nirgendwo endete, stand ich vor einer eigentlich leichten Entscheidung:
1) Umdrehen, den im GPS verfügbaren Weg wieder zurückfahren und ca. 15 Minuten verlieren.
2) Ohne GPS-Daten auf eigene Faust durch das Labyrinth fahren und darauf hoffen, dass die sandigen Wege mich irgendwann zurück auf die Strasse führen würden.
Vermutlich ahnt ihr, wofür ich mich entschieden habe...
Nach nur wenigen Minuten hatte ich mich hoffnungslos im Dschungel verirrt und fuhr willkürlich in jeden kleinen Pfad, den ich passierte. Bei Wendemanövern auf sandigem Untergrund kippte mir meine DL650 mehrfach um, sodass ich meine etwa 270 Kilo schwere Begleitung bei gefühlten 50°C wieder aufrichten musste. Ich glaube es erübrigt sich zu betonen, dass ich mit meinen Kräften und zunehmend auch Nerven am Ende war. Irgendwann ging ich ich dann zur Hänsel-und-Gretel Taktik über und setzte an jeder winzigen Kreuzung einen Wegpunkt in meinem GPS. So wusste ich zumindest, welche Pfade ich schon gefahren bin und konnte nach dem Ausschlussprinzip meine Chancen auf Erfolg verbessern. Und tatsächlich fand ich mit dieser Strategie nach gut einer Stunde den Weg zurück auf den Hauptpfad und konnte mich völlig entkräftet auf die asphaltierte Strasse retten.
Vielleicht war es ganz gut, dass mir mein Leichtsinn schon so früh fast das Genick gebrochen hätte. Ich reise allein und muss jedes Problem in das ich mich manövriere selbst lösen. In Zukunft werde ich nur noch auf Dschungelpfaden fahren, die dem GPS bekannt sind oder die ohne Abzweigungen geradeaus führen. Sobald ich auch nur Gefahr laufe mich zu verirren, werde ich umdrehen. Selbst wenn ich dadurch einen kompletten Tage verliere. Insbesondere mit Blick auf Kambodscha und Laos wird mich diese Erfahrung vielleicht noch vor Schlimmerem bewahren.
Die restliche Strecke bis nach Bangkok verlief dann sehr unspektakulär. Ich machte Station in Chumphon, Hua Hin (super Seafood!) und Ratchaburi bevor ich im Sivalai Place in Bangkok ankam. Dort wohnte ich während meines Austauschsemesters, kenne viele der Angestellten noch persönlich und fühle mich wirklich wie zuhause. Ungefähr drei Kilometer vor meiner Ankunft erkannte ich erste Restaurants, Geschäfte etc. bis ich mich plötzlich orientieren konnte und meine Suzuki voller Vorfreude durch die winzigen Gassen meiner zweiten Heimat steuerte. Kaum im Sivalai Place angekommen, begrüsste mich Oillie, die Managerin, schon mit einer riesigen Umarmung, Padthai (gebratene Nudeln) und einem Obstkorb – Willkommen daheim :)
30. Januar 2013

Das wirklich Besondere an meinem Vorhaben ist die interaktive Komponente. Dadurch könnt ihr meine Reise aktiv mitgestalten und so Teil meines Abenteuers werden. Über meine (www.facebook.com/stevensway.oflife) oder die Suzuki Facebookseite (www.facebook.com/suzukimotorraddeutschland) könnt ihr mir Aufgaben stellen, die ich in Angriff nehmen werde und anschliessend Bilder/Videos davon hier veröffentliche.
Viola hat als Erste diese Gelegenheit wahrgenommen und mich gebeten, zur „Eat Bakery“ zu fahren. In dieser Bäckerei stellt Kittiwat Unarrom Brote her, die menschlichen Leichenteilen zum verwechseln ähnlich sehen. Von Beginn an fand ich die Aufgabe interessant, ahnte aber schon, dass die Suche nicht einfach werden würde.
Auch nach intensiver Google-Recherche konnte ich keine bessere Ortsangabe als das doch sehr vage „in der Provinz Ratchaburi“ finden. Weder in Krabi, Chumphon noch Hua Hin hatte irgendjemand etwas von dieser Bäckerei gehört; es blieb mir also nichts anderes übrig, als unvorbereitet in die Stadt Ratchaburi zu fahren. Kaum angekommen, beschleicht mich der Verdacht, ich könnte der einzige Tourist in diesem verschlafenen Städtchen sein. Es gibt praktisch keine englischen Schilder und auch nach 30-minütiger Irrfahrt durch die Stadt habe ich immer noch kein Hotel bzw. Guesthouse finden können. Die Wegbeschreibungen der Einheimischen stellen sich entweder als falsch heraus oder sind derart detailliert, dass ich sie mir nur zwei Strassenkreuzungen weit merken kann. Etwas ernüchtert biege ich um die nächste Ecke und erkenne aus dem Augenwinkel ein Wappen mit den Worten „Education Comission“: Eine Bildungseinrichtung! Dort müssen sie einfach englisch sprechen.
Ich biege also in den Schulhof ein und werde – bestaunt von ca. 50 Schülern – gleich vom Direktor und drei Lehrern in Empfang genommen. Leider beherrschten auch sie englisch mehr schlecht als recht und verbrachten die nächsten zehn Minuten damit, angeregt miteinander zu diskutieren, eine Karte von Hand zu malen und wild in alle Himmelsrichtungen zu gestikulieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Hoffnungen eigentlich schon begraben und schaute mir das Schauspiel mit einem erstaunten Lächeln an, als mich ein Lehrer sanft am Arm neben sich auf eine Bank zog. Nach den typischen Vorstellungsfloskeln möchte er wissen, ob ich schon zu Mittag gegessen habe. In Thailand bedeutet diese Frage deutlich mehr als der Inhalt erahnen lässt. Sie dient weniger der Informationsgewinnung als mehr dem vorsichtigen Abtasten, ob ich mich mit ihm unterhalten möchte. Daher versicherte ich ihm, dass ich noch nichts gegessen habe und grossen Hunger hätte, worauf er mich in ein benachbartes Restaurant einlädt. Dort erzähle ich ihm von meiner Reise und er vermittelt mir interessante Einblicke in das politische System in Thailand. Anschliessend begleitet er mich mit seinem Moped zu einem Hotel und lädt mich zum gemeinsamen Abendessen mit seiner Familie ein. Diese Einladung nehme ich freudestrahlend an und verbeuge mich zum Abschied.
Später erklärte er mir seine Gastfreundschaft wie folgt: „Wenn du lächelst, helfe ich dir. Und wenn du Interesse an mir zeigst, verbringe ich Zeit mir dir.“ Diese Aussage hat mich wieder mal daran erinnert, dass Gastfreundschaft keine Einbahnstrasse ist, sondern sich immer durch respektvolles Verhalten verdient werden muss. Danke für diese Lektion.
Vor dem Abendessen fahre ich noch schnell bei einer Wäscherei vorbei, um ein paar T-Shirts abzugeben und auch dort nach der Bäckerei zu fragen. Zu meinem Erstaunen kennen sie die „Eat Bakery“ und können mir nach einigen Telefonaten sogar eine handgemalte Karte überreichen.
Nach einem herausragenden Abendessen mache ich mich also am nächsten Tag bewaffnet mit einer Handzeichnung, einer Telefonnummer und einer Extraportion Optimismus auf den Weg. Photharam, das Dorf in dem die Bäckerei sein soll, finde ich auf Anhieb und auch die Zielstrasse glaube ich schon nach weiteren zehn Minuten ausgemacht zu haben. Nur die Bäckerei lässt noch auf sich warten. Also halte ich an einem kleinen Strassenrestaurant und versuche in bestem Thai-Englisch „Eat Bakery“ verständlich auszusprechen: „Eat Bakelyyyyyyy?“ Tatsächlich versteht mich die Frau nach dem zweiten Versuch und bittet ihren Kollegen, mir den Weg zu zeigen. Dieser führt mich am verlassenen Verkaufsgebäude vorbei zur eigentlichen Bäckerei im Hinterhof. Ein junger Mann mit schüchternem Lächeln stellt sich mir als Kittiwat Unarrom vor – hier bin ich richtig!
Es stellt sich heraus, dass Kittiwat das 'menschliche' Brot nicht mehr herstellt, sondern nun an ganzen Brotskulpturen experimentiert. Sobald er diese in hoher Qualität backen kann, wird er auch den Verkaufsraum wieder öffnen. Bis dahin ist die Eat Bakery eine fast normale Bäckerei – abgesehen von den erschreckend realistischen 'menschlichen' Brotlaiben, die noch immer in der Bäckerei verstreut sind. Nach einer kurzen Erkundungstour durch seine Backstube schenkt mir Kittiwat ein Kokosbrot und ich mache mich nach einem leckeren Mittagessen im zuvor besuchten Strassenrestaurant auf den Weg nach Bangkok.
Meine erste Aufgabe stellte sich als deutlich schwieriger heraus als ursprünglich angenommen. Umso glücklicher bin ich, dass ich die „Eat Bakery“ schlussendlich doch noch finden konnte und auf meiner Suche viele äusserst freundliche Menschen getroffen habe. Insbesondere möchte ich da die nette Familie aus Ratchaburi hervorheben, die ich vielleicht bei meinem zweiten Thailandaufenthalt im März nochmals besuchen werde.
Schaut euch das HD-Video meiner Suche an und stellt mir weitere Aufgaben! Jetzt habe ich so richtig Gefallen am interaktiven Konzept gefunden und bin schon ganz gespannt auf eure Einfälle.
28. Januar 2013
Was für ein fantastisches Wochenende! Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll mit meiner Erzählung... Am besten im Oktober 2011: Damals war ich das erste mal in Malaysia und wanderte ohne jegliche Planung durch den Dschungel der Taman Negara. Alle meine Sachen hatte ich in Jerantut, ca. 30km vom Nationalpark entfernt, zurückgelassen. Als ich nach mehreren Stunden matschig, nass und verschwitzt die Bushaltestelle erreichte, musste ich feststellen, dass der letzte Bus schon vor über einer Stunde abgefahren war. Ich stehe also ohne Geld, Gepäck oder Plan B an der Hauptsrasse und bin etwas ratlos. In diesem Moment hält Aishah mit ihrem Auto neben mir an und bietet an, mich bis Jerantut mitzunehmen – gratis. Aber nicht nur das: Da sie meine Begeisterung für die malaiische Küche erkennt, empfiehlt sie mir sogar noch einen Night Market, der das beste Essen der Stadt hat. Ich war ihr unglaublich dankbar und blieb mit ihr seitdem über Facebook in Kontakt. Nun luden sie und ihre Familie mich zu sich nach Hause ein; ein Angebot, dem ich nur zu gerne folgte.
Am Samstagabend komme ich nach recht ereignisloser Fahrt in Jerantut an und werde an meinem Hotel von Aishah und ihrem Bruder abgeholt. Ich folge ihrem Auto mit meiner V-Strom, um sie bei Aishahs Familie sicher abzustellen. Ihre riesige Familie (Aishah hat elf Geschwister) nimmt mich direkt herzlich auf, auch wenn Aishah die Einzige ist, die englisch spricht. Nach Tee und Snacks fahren wir mit Aishah, ihrer Mutter, zwei Brüdern, ihrer Schwägerin, einer Nichte und zwei Neffen zum lokalen Markt, um verschiedene Spezialitäten zu kaufen. Falls man es noch nicht herausgehört hat: Ich LIEBE Essen und alles was damit zu tun hat! Dementsprechend fasziniert war ich beim Anblick der bestimmt 200 Essensstände, was Aishah wohl nicht verborgen blieb, denn sie stoppte an jedem zweiten Stand, um mir etwas über die dort verkaufte Delikatesse zu erzählen. Wie ein kleines Kind im Süssigkeitenladen folge ich Aishah mit Staunen und lausche ihren Ausführungen, die ab und zu von einem herzlichen „Hello, Sir!“ der Verkäufer unterbrochen wurden – ich war der einzige Westler auf dem Markt...
Nach einiger Zeit kehren wir mit sechs Tüten bepackt zum Auto zurück und fahren Richtung Stadtpark, um dort ein Picknick zu haben. Auch hier führt mich Aishah ebenso liebevoll wie zielsicher an allen Fettnäpfchen vorbei, indem sie mir zum richtigen Zeitpunkt das passende Getränk/Essen in die Hand drückt und mir zeigt, wie man es isst. Obwohl ich mich nur mit Aishah unterhalten kann, merke ich durch Gesten und Blicke der restlichen Familie, dass ich willkommen bin. Nur selten hatte ich einen so schönen Abend verbracht und selbst jetzt beim Schreiben kann ich mir ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen.
Am nächsten Morgen frage ich – wie eigentlich immer – die Einheimischen nach ihrem Lieblingsfrühstück. In Jerantut herrschte bei dieser Frage ungewohnte Einigkeit: Sayids Roti Canai Laden! Roti Canai ist ein sehr dünner Teig, der mit Fett bestrichen ausgebacken und dann mit Currydips serviert wird. Ich bin noch keine drei Schritte im Laden, als mich die seltsame Gewissheit beschleicht, dass ich ein aussergewöhnliches Frühstück haben werde: Der Laden ist hoffnungslos überfüllt, man versteht sein eigenes Wort kaum und sitzt auf kleinen, dreckigen Plastikstühlen. Drei sichere Anzeichen eines guten Restaurants. Ich setze mich zu einem Einheimischen an einen 8er-Tisch, der sich schnell mit weiteren fünf Personen füllt. Als einziger Westler bin ich wieder mal die Attraktion schlechthin und jede meiner Bestellungen wird lautstark von meinen Sitznachbarn an die Theke gerufen, um sicherzustellen, dass ich jederzeit einen Roti und Tee vor mir stehen habe. Zwei der Locals sprechen etwas englisch und sind hellauf begeistert von meiner Reise. Sie übersetzen jedes meiner Worte, die von aufgeregtem Brummen und ungläubigem Kopfschütteln aufgenommen werden. In der Folge bin ich das Gesprächsthema Nummer 1 und bestelle einen weiteren Roti mit Tee. Etwa eine Stunde esse, rede, scherze und lache ich mit meinen neugewonnen Freunden, bevor ich langsam aufbrechen muss. Zu meiner grossen Überraschung hat der älteste Mann am Tisch bereits meine Rechnung beglichen und mich zum Frühstück eingeladen. Beim Verlassen klopft mir jeder der sechs Männer auf die Schulter und nickt mir anerkennend zu – was für eine tolle Erfahrung! Das war glaube ich das beste Frühstück meines Lebens.
Ich verlasse Sayids Roti Laden und sehe schon Aishahs Auto vor meinem Hotel stehen. Sie und ihr Bruder fahren mich zu ihrem Haus, wo mich ein unvergesslicher Tag erwartet. Mit Aishahs Nichte und Neffen besuchen wir nahegelegene Höhlen und verbringen den Nachmittag mit typischen malaiischen Brettspielen und Murmeln. Dazwischen geniesse ich mit zehn anderen Familienmitgliedern ein selbstgekochtes Festmahl: Fisch, Hühnchen, Rind, Gemüse, gebratener Reis, Früchte, Dessert und Tee. Wunderbar!
Aishahs ältester Bruder zeigt mir anschliessend, wie man eine Kokosnuss öffnet und als kleines Dankeschön bringe ich ihm bei, wie man ein Schaltmotorrad fährt. Bisher ist er nur kleine Roller gefahren und hat schon den ganzen Tag die Suzuki mit grossen Augen bestaunt. Nach zwei Versuchen hat er den Dreh schnell raus und kommt stolz wie Oskar von seiner kleinen Spritztour zurück.
Am nächsten Morgen lade ich die Familie zum Frühstück ein (EUR 3,25 für fünf Personen) und schiesse ein paar Abschiedsfotos mit ihnen. Aishahs Mutter hat mich spätestens jetzt ins Herz geschlossen. Auf der gesamten Rückfahrt schnattert sie ununterbrochen in Malay, wobei ich immer wieder die Worte „moto“, „Suzuki“ und „Europe“ verstehe. Bei ihrem Haus angekommen, werde ich ausgiebig verabschiedet und mache mich auf den Weg nach Jeli und Penang.
Ich weiss gar nicht, wie ich mich jemals dafür bei Aishah gebührend bedanken kann. Das war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Sie ist sehr religiös aber aufgeschlossen; sehr traditionsbewusst und neugierig; ein gewissenhafter Familienmensch und humorvoll. Eine Mischung, die ich für ausgeschlossen hielt. Ich bin meine Reise angetreten, um mehr über das Leben zu lernen und etwas erfahrener zurückzukehren. Nun habe ich meine erste wichtige Lektion gelernt: Bevor ich Neues lernen kann, muss ich alle Irrtümer und vorschnellen Schlussfolgerungen ausräumen. Erst dann kann ich unbefangen auf Menschen zugehen und wirklich von ihnen lernen. Danke Aishah für dieses traumhaft schöne Wochenende, für deine Gastfreundschaft und für diese wertvolle Lektion!
Abenteuerliche Grüsse aus Penang (Malaysia),
Steven
25. Januar 2013

Nach mehr als 16 Stunden im Flugzeug und einem Zwischenstopp in Muscat (Oman) bin ich am Dienstagabend endlich in Kuala Lumpur (Malaysia) gelandet. Jetzt muss ich nur noch den Jetlag schnellstmöglich abschütteln und mein Motorrad durch den Zoll bekommen, bevor es losgehen kann.
Bei Zollfragen in asiatischen Ländern erwartet man eigentlich eine Geschichte von Blut, Schweiss und Tränen. Der Grund, warum meine Geschichte weit weniger abenteuerlich ausfällt, heisst Kevin. Um möglichst schnell zum Cargoterminal zu gelangen, habe ich in KL beim YouniQ Hotel direkt am Flughafen reserviert und gleich den Transfer mitorganisiert. Ich komme also an, werde sofort von Kevin, dem Hotelmanager, am Flughafen begrüsst und wir kommen ein bisschen ins Gespräch. Er ist so begeistert von meinem Vorhaben, dass er mich zwei Nächte gratis übernachten lässt und sich den kompletten nächsten Tag frei nimmt, um mit mir die Suzuki durch den Zoll zu schleusen.
Und tatsächlich steht er am nächsten Morgen pünktlich mit seinem Auto und einer Flasche Wasser bereit, um sich mit mir in die Abgründe malaiischer Bürokratie zu stürzen. Schon bald wurde mir klar, wie glücklich ich mich schätzen durfte, Kevin an meiner Seite zu haben. In den nächsten gut fünf Stunden hetzten wir durch ca. 15 Büros, die willkürlich auf dem riesigen Zollareal verteilt waren. Ohne eigenes Auto ist das eigentlich nicht zu schaffen. Zum Teil hatte das Prozedere schon humoristische Züge: Man bekommt ein Dokument in Gebäude A, das man in Gebäude B am anderen Ende des Zollbereichs abstempeln lassen muss, nur um es im Gebäude A danach zur Unterschrift vorzulegen. Mit dem nun unterzeichneten Formular durfte man zurück zu Gebäude B, um das nächste Dokument zu erhalten. Das Ganze erinnerte mich etwas an das „Haus, das Verrückte macht“ aus Asterix & Obelix.

Aus Platzgründen mussten wir das Vorderrad und einige andere Kleinteile in Deutschland abmontieren. Wir brauchten also Hilfe, um die Suzuki aus dem Gestell zu schieben und das Rad zu montieren. Dieses „Problem“ war dann der dringend benötigte Weckruf: „Steven, du bist in Asien!!“. Als die Einheimischen nur den Suzuki Karton sahen, sammelte sich sofort eine sieben Mann starke Gruppe, die sich mit fast schon kindlicher Freude auf das Motorrad stürzten und es praktisch in Eigenregie zusammenbauten. Ich rutschte – mal wieder – in die Zuschauerrolle, nickte nur die vorsichtigen Nachfragen der Jungs ab und verteilte Werkzeug - „This screw here, boss?“, „You have tool, boss?“, „Nice bike, boss!“. Die Szene hatte etwas von Schulfreunden, die gemeinsam ihr neues Lego-Set zusammensetzen. Nach weniger als 30 Minuten waren wir fertig, ich bedankte mich bei allen Helfern persönlich und schenkte ihnen das Gestell zum Weiterverkauf.
Krönender Abschluss des Tages war dann das erste Anlassen der DL650 auf asiatischem Boden. Ich war dreckig, verschwitzt und ausgelaugt vom Jetlag, hatte aber wohl noch nie so ein breites Grinsen der Erleichterung auf dem Gesicht. Auf diesem Motorrad werde ich die nächsten sieben Monate verbringen. Es wird mein treuer Begleiter sein und hoffentlich mein Garant für viele unvergessliche Erlebnisse sein. Jetzt geht’s los!
Die ersten drei Fahrtage verliefen dann auch gleich super. Am ersten Tag ging es gut 200km von Kuala Lumpur auf den Bukit Fraser, einen ca. 1400m hohen Berg. Eine erste positive Überraschung erlebte ich in Kuala Lumpur: Ich befürchtete einen ähnlichen Fahrstil, wie ich ihn 2011 auf Java (Indonesien) angetroffen habe, wurde aber wieder mal eines Besseren belehrt. In Malaysia benutzt man tatsächlich seine Blinker, fährt nicht einfach blind aus Kreuzungen heraus und Busse/LKWs überholen nicht nach Lust und Laune, sodass man auf den Seitenstreifen ausweichen muss. Dazu ist der Strassenbelag wirklich gut und die Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten nicht für Motorradfahrer. Die erste Etappe zum Bukit Fraser führte auf kurvigen Strassen durch kleine Dörfer und tropische Vegetation immer höher den Berg hinauf. Nach ca. drei Stunden lagen Kuala Lumpur und die Genting Highlands bereits hinter mir, als ich ein vielversprechendes Schild las: „Oneway road“ Die letzten 8km zum Gipfel des Bukit Fraser ging es also ohne Gegenverkehr auf einer fantastischen kleinen Strasse nach oben. Auf der einen Seite eine Felswand auf der anderen ein steiler, mit Palmen bewachsener Abhang. So einen Fahrpass hatte ich glaube ich noch nie in meinem Leben! Schaut euch einfach das GoPro Video an, um meine Begeisterung nachvollziehen zu können:
Auf dem Gipfel angekommen beginne ich gerade mit der obligatorische Suche nach einer Unterkunft mit sicherer Parkmöglichkeit, als ich eine andere V-Strom mit australischem Nummernschild sehe: Christine und Clive sind hier! Das australisch/britische Ehepaar fährt ebenfalls von Malaysia nach Europa und hat mich vor einigen Wochen über das Bikerforum HorizonsUnlimited kontaktiert. Ich wusste zwar, dass sie ungefähr in dieser Region sind, nicht aber, dass ich sie schon am ersten Tag treffen würde. Ich schmeisse nur schnell Helm und Jacke aufs Zimmer, setze mich zu ihnen und bestelle gebratenen Reis mit Shrimppaste und mein erstes Bier in Malaysia. Wir unterhalten uns einige Zeit über unsere jeweilige Route und tauschen Anekdoten über die Strassen Südostasiens aus. Einen schöneren ersten Tag hätte ich mir wirklich nicht erträumen können. Glücklich und völlig übermüdet falle ich noch vor 22 Uhr ins Bett und schlafe direkt ein.
Am nächsten Morgen genieße ich das leckere Frühstück im Hotel und mache mich gegen 10 Uhr auf den Weg. Bevor ich Richtung Cameron Highlands aufbreche, muss ich aber einfach noch mal die Oneway Strasse geniessen ;) Also geht’s die Strasse runter, rauf und wieder runter und erst dann zu den nordwestlich gelegenen Teeplantagen der Cameron Highlands. Die Strasse dorthin ist neu gebaut und besteht praktisch ausschliesslich aus langgezogenen Kurven, die man bequem mit 100 im sechsten Gang fahren kann. Dementsprechend bin ich nach gut vier Stunden schon im Hotel unter der Dusche und überlege, wie ich den Abend am besten nutzen kann. Im Endeffekt entscheide ich mich dafür, einfach gar nichts zu machen; ich setze mich in ein kleines indisches Restaurant, trinke einen Tee nach dem anderen, esse Roti Canai und schaue mir auf verschiedenen Onlineportalen an, was so im Rest der Welt passiert ist.
Schon jetzt merke ich, dass ich wieder in Reisestimmung komme. Die Nachrichten über Krieg und Geiseldrama erscheinen unwirklich weit weg; fast schon aus einer anderen Welt, wenn ich mich an die kleinen Dörfer entsinne, die ich nur wenige Stunden vorher durchquert habe. Schnell schliesse ich meinen Laptop wieder und wundere mich nach über drei Stunden, wie die Zeit bloss so schnell verfliegen konnte. Das ist genau der Grund, warum ich allein reise. Ich muss nichts planen, kann sehr spontan sein und kann wenn ich denn möchte, einen ganzen Abend einfach nur mit meinen Gedanken allein sein und den Moment geniessen.
Morgen fahre ich nach Jerantut, dem Tor zum Nationalpark Taman Negara. Dort ist mir eine junge Frau vor 1,5 Jahren in einer misslichen Situation zu Hilfe gekommen und ich möchte die Gelegenheit nutzen und sie besuchen. Ich bin schon gespannt, was Aishah mit mir vor hat und freue mich auf die Zeit mit ihr und ihrer Familie.
Bis dann verbleibe ich mit abenteuerlichen Grüssen,
Steven
21. Januar 2013
In den nächsten sieben Monaten werde ich mit meiner treuen Suzuki V-Strom 650 ABS von Malaysia bis nach Deutschland fahren. Mehr als 25000 km durch 20 Länder werden mich durch Dschungel, Wüsten, den Himalaya, Hindukush und die Alpen führen. Und das Wichtigste: Es wird ein interaktiver Road Trip, den ihr aktiv mitgestalten könnt.
Entstanden ist diese - zu Beginn buchstäbliche - Schnapsidee in den Bergen des nördlichen Laos. Suzuki und MOTORRAD helfen mir nun dabei, diesen Traum umzusetzen.
Wer ich bin?

Ich bin Steven, 23 Jahre alt und komme gebürtig aus Würzburg im schönen Unterfranken. Bis vor kurzem war mein Leben denkbar unspektakulär: Schule, Abitur, Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen. Dann jedoch traf ich die bisher beste Entscheidung meines Lebens. Als Austauschuniversität wählte ich nicht die weltweit bekannten Business Schools in den USA oder England sondern folgte meinem Bauchgefühl und ging an die Thammasat University nach Bangkok (Thailand).
Überwältigt von den vielen Eindrücken, versuchte ich alles wie ein Schwamm in mich aufzusaugen und so viel von der südostasiatischen Kultur zu erleben wie nur irgendwie möglich. Auch deshalb begann ich mehr und mehr Thailand und seine Nachbarländer per Motorrad zu erkunden. Wann immer ich Zeit hatte, mietete oder kaufte ich mir einen fahrbaren Untersatz (eine positivere Bezeichnung wäre eine gnadenlose Beschönigung) und fuhr kreuz und quer durch Thailand, Malaysia, Indonesien (Java) und Laos. Insbesondere Laos hat mich verzaubert mit seiner friedlichen, fast schon mystischen Ruhe. In dem armen Binnenstaat fuhr ich in zwei Monaten mehr als 5000 km im gesamten Land und hatte unzählige Begegnungen mit Menschen, die mir bis heute nicht aus dem Kopf gehen. „Sich treiben lassen“ ist ein von vielen Reisenden inflationär verwendeter Satzfetzen, den ich in Laos erstmals wirklich gespürt habe. Die Erfahrungen, die ich in Laos machen durfte, haben mich tief beeindruckt und nachhaltig in meinem Denken und hoffentlich auch Handeln verändert.
Diese Veränderung möchte ich weiterführen und gehe mit der nun anstehenden Reise den logischen nächsten Schritt. Meine Route wird mich durch Südostasien, Nepal, Indien, Pakistan, Iran, Irak, Türkei und Europa führen. Dort werde ich Menschen verschiedenster Kulturen, Religionen und Lebensansichten treffen und hoffentlich viele Dinge von ihnen lernen können.
Interaktiv mitgestalten - wie funktioniert das?
Ein Blog ist schön und gut, aber ich möchte nicht einfach vor mich hin und möglicherweise gar an den Lesern vorbei schreiben, sondern mit euch in Kontakt stehen. Natürlich habe ich mir eine grobe Route zurechtgelegt, aber die detaillierte Planung ist noch völlig offen. Wenn ihr eine tolle Idee habt, wie ich meine Reise interessanter gestalten kann, schreibt es mir via Facebook und ich werde euren Wunsch soweit möglich umsetzen. Kennt ihr etwa einen tollen Bergpass in Indien oder eine ausgefallene Delikatesse in Kambodscha oder ein super Restaurant in Nepal? Erzählt mir davon, ich werde dorthin fahren und Bilder/HD Videos (GoPro) machen, die ich direkt mit euch hier teilen werde. So werdet ihr Teil meiner Reise und seid wirklich hautnah dabei wenn ich 25000 km um die halbe Welt fahren werde.
Eure Ideen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr direkt über meinen Facebook Account senden (Steven's Way Of Life) oder direkt hier bei MOTORRAD online posten:
Was wurde am Motorrad verändert?

Natürlich sind die Anforderungen ans Motorrad bei einer solchen Reise enorm und unterscheiden sich stark von denen in Deutschland auf befestigten Strassen. Dementsprechend nahm mich Rainer Wolf von R.S. Wolf unter seine Fittiche und hat mich unglaublich unterstützt. Nicht nur mit diversen Zubehörteilen, sondern auch mit der jahrelangen Abenteuerreisen- und Rallyeerfahrung aller Mitarbeiter/innen. Einfach fantastisch. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken bei allen Beteiligten (Petra, Uwe, Matthias und Rainer). Folgende Zubehörteile wurden verbaut:
- Handprotektoren von SW-Motech
- Koffersystem von SW-Motech
- Kettenschmiersystem von CLS2000
- Heizgriffe von CLS2000
- Zwei extralaute Hupen
- Karosserieschutz von SW-Motech
- Unterbodenschutz von SW-Motech
- Breitere Fussrasten von SW-Motech
Viele kleine Änderungen wie verstärke Kabel, ein umpositionierter Kabelbaum, verbesserte Isolierung etc. sind auf die Erfahrungen der Mechaniker zurückzuführen und werden mir sicherlich sehr bei meinem Vorhaben helfen.
Dazu gabs noch ein Garmin Montana, das vom GPS-Experten Matthias Zörcher mit diversen Kartensätzen ausgestattet wurde. Matthias hat mir auch noch mit viel Geduld (die ist bei mir mehr als nötig) sämtliche Funktionen des Garmin Montanas erklärt und mich in BaseCamp, die Navigationssoftware von Garmin eingearbeitet. Jetzt kann ich eigenständig Routen erstellen, diese mit GoogleEarth analysieren und gegebenenfalls anpassen. Mit meinen Strassenkarten und dem tollen Navi sollte die Orientierung beim besten Willen kein Problem darstellen :)
Ich freue mich schon auf euer Feedback und eure kreativen Vorschläge zur interaktiven Mitgestaltung meiner Reise.
Abenteuerliche Grüsse,
Steven
18. Februar 2013
„Warum machst du das bloss alleine? Kannst du nicht noch einen zweiten Verrückten finden? Bist du dann nicht einsam?“
So ähnlich lautete die wohl meistgestellte Frage an mich im Vorlauf meiner Reise. Für Menschen, die noch nie durch Asien gereist sind, ist es nur schwer vorstellbar, dass Einsamkeit dort ein Ding der Unmöglichkeit ist. Man trifft einfach überall Einheimische, andere Reisende oder Auswanderer, mit denen man gemeinsam Zeit verbringt. Gerade als Alleinreisender wird man besonders oft angesprochen und hat dadurch ironischerweise sogar mehr soziale Kontakte als Gruppenreisende. In Kambodscha zeigte sich dieses Phänomen durchgehend:
In Bangkok verliess ich nach vier tollen Tagen mit alten Freunden den Sivalai Place und machte mich auf in Richtung Kambodscha. Meinen letzten Stopp in Thailand machte ich in der Nähe von Klaeng (Rayong), wo mich die Eltern einer guten Freundin zu sich nach Hause eingeladen haben. Sie holten mich in Klaeng ab, zeigten mir den Essensmarkt und kauften einige lokale Spezialitäten, die wir am Abend mit der gesamtem Familie geniessen würden: Hähnchen, Rochen, Shrimps, Mango mit Klebreis, Desserts... Das gemeinsame Abendessen war dann auch überraschend lustig. Einige Familienmitglieder konnten etwas englisch sprechen und zusammen mit meinen Thaikenntnissen, Händen, Füssen und reichlich Wein verstanden wir uns bestens. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von der Familie und setzte meinen Weg nach Kambodscha fort.

An der Grenze angekommen bemerkte ich eine 200cc Lifan und traf nur wenige Meter weiter am Zollhäuschen Heinz, den deutschen Besitzer der Maschine. Er ist ca. Mitte 50 hat schon fast überall in der Welt gelebt und wohnt derzeit in Chiang Mai (Thailand). Wir verstehen uns auf Anhieb und beschliessen, die Fahrt nach Sihanoukville gemeinsam in Angriff zu nehmen. Da wir uns beide nicht wirklich über die Stadt informiert haben, landen wir am völlig verlassenen Ende von Sihanoukville und checken im äusserst verlockend klingenden Snake-Guesthouse ein. Nach einer Dusche stehen wir unten im Hof bei den Maschinen und sind etwas ratlos, wie wir in dieser Geisterstadt den Abend verbringen sollen. In diesem Moment kommen Roman, Jana und Daniel, eine russische Familie auf uns zu und Roman sagt freudestrahlend: „Wenn ihr bei irgendetwas Hilfe braucht, sagt mir Bescheid! Ich helfe euch sehr gerne!“
Fantastisch! Heinz sucht eine Tankstelle, ich einen Geldautomat und wir beide ein gutes Restaurant. Kaum ist unser Wunsch ausgesprochen, schwingt sich Roman auf seinen Roller und führt uns die ca. fünf Kilometer ins Stadtzentrum. Vollgetankt und mit frischem Geld ausgestattet sitzen Heinz und ich nur wenig später überglücklich vor einem riesigen Grillteller in einer Strandbar und schmieden Pläne für den nächsten Tag. Als wir gegen 22:00 Uhr den Rückweg antreten möchten, finde ich an meiner Navihalterung einen Zettel. Mein erster Gedanke war „Mist, Strafzettel“, aber die gibt es glücklicherweise in Kambodscha nicht. Jana und Harold, zwei Deutsche, die exakt meine Route in umgekehrter Richtung gefahren sind, haben mir eine kleine Karte zu ihrem Guesthouse gemalt und mich auf ein Bier eingeladen.

Sofort schmeisse ich alle Planungen für den nächsten Tag über Bord und fahre mit Heinz zum Panda Guesthouse, in dem uns Jana und Harold gleich herzlich in Empfang nehmen. Die nächsten zwei Stunden tauschen wir haarsträubende Anekdoten aus, wie sie nur Motorradreisende erleben können, fachsimpeln über unsere Maschinen und stimmen unsere weiteren Routen etwas ab. Die beiden sind sehr nett und lustig und können mir dazu noch wertvolle Tipps für meine weitere Reise geben. Daher beschliesse ich, noch einen Tag in Sihanoukville zu bleiben, während Heinz schon weiter Richtung Phnom Penh fährt – eine sehr gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Praktisch den gesamten Tag frage ich Jana und Harold Löcher über ihre Erfahrungen in den Bauch; insbesondere über das Stück in Pakistan. Beide bestätigen meine Einschätzung, dass es unbedenklich ist, geben mir aber dennoch einige Kontakte, die sich sehr gut auskennen und die aktuelle Sicherheitslage gut bewerten können. Lustigerweise sind Jana und Harold auch auf Suzuki V-Stroms unterwegs und hatten auf ihren 25.000 km nicht eine einzige Panne - nicht mal einen Platten. Hoffen wir, dass ich auch so viel Glück habe.
Am nächsten Morgen schwinge ich mich wieder auf meine DL650, um die gut 300 Kilometer entfernte Hauptstadt Phnom Penh anzusteuern. Der Verkehr dort ist vorsichtig ausgedrückt wahnsinnig. In einem Anflug absoluter Anarchie fahren Autos, Busse, LKWs und endlos viele Mopeds kreuz und quer über rote Ampeln, Fusswege etc. Absolut verrückt! Dagegen ist Bangkok ein Vorbild an Ordnungsliebe. Nach etwa einer Stunde im dichten Stadtverkehr erreichte ich die Hotel- und Barstrasse direkt am Mekong und konnte meinen Augen kaum trauen: Vor einem kleinen Hotel stand eine orangefarbene 200cc Lifan – ich habe Heinz wiedergefunden in der zwei Millionen Metropole.

Da ich meist deutlich früher ins Bett gehe als Heinz, verabschiedete ich mich kurz nach unserem gemeinsamen Abendessen und machte mich am nächsten Morgen zeitig auf die Suche nach einem typisch kambodschanischen Frühstück. Nur wenige Strassen weiter traf ich die drei unfehlbaren Anzeichen eines guten Restaurants an: Es war dreckig, laut und man sass auf Plastikstühlen. Wie in fast ganz Südostasien wurde auch an diesem Stand eine herrlich duftende Nudelsuppe mit Fleisch und allerlei Würzmöglichkeiten serviert. Diese sind eigentlich das Wichtigste; es gibt starke und schwache Fischsauce, getrocknete Chilis, Chilipaste, Salz, Pfeffer, Zucker, Limone, Sojasauce... Ganz vertieft in diese Suppen-Alchemie bemerkte ich erst einige Minuten später, dass mich mein Sitznachbar interessiert beobachtete. Er stellte sich mir kurze Zeit später als Boun Houen vor und wir unterhielten uns daraufhin etwa 1,5 Stunden lang über die Unterschiede zwischen Kambodscha und Deutschland, meine Reise und selbstverständlich Suppe ;)
Am nächsten Tag wollte ich den ersten Service in Phnom Penh durchführen lassen. Dank meiner aussergewöhnlichen Gabe, mich trotz GPS und Landkarte verfahren zu können, verpasste ich allerdings das grosse Suzuki Service-Center und landete in einer winzigen Werkstatt. Dort bot mir Dalin, ein junger Englischlehrer, Hilfe an, führte mich zur Suzukizentrale und übersetzte dort sogar noch für mich. Etwa 45 Minuten später hatte meine DL650 alle Tests mit Bravour bestanden und ich ging mit Dalin Mittagessen. Seine Geschichte ist wirklich beeindruckend. Er wurde als eines von fünf Kindern in eine sehr arme Familie im ländlichen Kambodscha geboren.
Da die öffentlichen Schulen nur unzureichende Bildungsmöglichkeiten boten, arbeitete er schon als Kind, um sich so einige Nachmittag an einer Privatschule leisten zu können. Mit diesem Wissen fand er in Phnom Penh Arbeit als Kellner und zog mit Westlern in eine Wohngemeinschaft, um seine Englischkenntnisse weiter zu verbessern. Heute ist er Englischlehrer an einer Privatschule und wird in den nächsten Jahren an der nationalen Universität lehren.
Wie viel Glück ich doch hatte, in Deutschland geboren worden zu sein. Ohne Gegenleistung erwarb ich mit meiner Geburt das Anrecht auf gute Bildung und bin mir vielleicht gerade deshalb meiner aussergewöhnlichen Situation nur selten bewusst. Dalin ist ebenfalls 23 Jahre alt und mir auch in seiner Art recht ähnlich. So fiel es mir leicht, mich in seine Lage hineinzuversetzen und ich muss leider zugeben, dass ich wohl nicht seinen Kampfgeist gezeigt hätte. Wäre ich – als sonst exakt gleicher Mensch - in Kambodscha geboren, wäre ich heute ein bettelarmer Bauer; nur durch einen anderen Geburtsort bereise ich heute die Welt mit einem guten Schul- und Studienabschluss. Ein ernüchternder Gedanke, der mich hoffentlich immer auf dem Boden halten wird.
Nach einer recht ereignislosen Fahrt nach Siem Reap, der unmittelbar an Angkor Wat grenzenden Stadt, genoss ich gerade mein indisches Abendessen, als mir eine junge blonde Frau auffiel. Sie lächelte unentwegt und war sehr höflich und respektvoll zur Bedienung. Kurzentschlossen sprach ich sie an, ob wir uns ein Tuk-Tuk zu den Tempelanlagen teilen möchten. Zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass Johanna aus Schwaben kommt und in Würzburg (meiner Heimatstadt) Fotografie studiert hat – was für ein Zufall! Wir unterhalten uns einige Zeit über Fotografie und unsere Reisepläne, bevor wir uns entscheiden, den nächsten Tag einfach zu entspannen und erst tags darauf Angkor Wat zu erkunden. Johanna ist sehr nett, intelligent, unkompliziert und lustig; kurzum: Die perfekte Reisebegleitung. Scherzhaft schmiedeten wir schon Pläne, wie wir einen Beiwagen an mein Motorrad schweissen oder eine Tuk-Tuk Anhängerkupplung anbringen können (Entwarnung an Suzuki: Ich habe beide Ideen wieder verworfen ;) ).
Angkor Wat selbst war zwar sehr schön und beeindruckend, konnte aber nicht ganz mit den funkensprühenden Lobeshymnen (Stichwort: Achtes Weltwunder) mithalten. Dennoch war es ein sehr schöner Tag, den wir standesgemäss in der berühmt-berüchtigten Bar Angkor What? ausklingen liessen. Natürlich nur mit maximal zwei Bier, da ich am nächsten Tag nach Laos fahren würde... Laos, meine heimliche Liebe, seit ich im letzten Jahr zwei Monate mit einem Motorrad kreuz und quer durch das bergige Land gefahren bin. Dort habe ich so viel gelernt wie vielleicht nirgendwo sonst in einer solch kurzen Zeitspanne und viele Begegnungen durchlebe ich in Gedanken oder Träumen immer und immer wieder. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlen wird, wenn diese Traumwelt wieder Realität wird. Auf nach Laos!
Als ich jedoch links in Richtung Udomxai abbog, erwartete mich das andere – so viel typischere – Laos: 75 Kilometer auf einer fast unerträglichen Buckelpiste. Wohin man blickte Schlaglöcher, manche bis zu 30 Zentimeter tief. Das Schlimme waren nicht mal unbedingt die Strassenschäden selbst, sondern die dilettantischen Ausbesserungsarbeiten. Einige der grössten Schlaglöcher wurden einfach mit lockerem Sand und groben Steinen zugeschüttet, die sich mit der Zeit auf der gesamten Fahrbahn ausgebreitet hatte.
Nach jedem LKW dauerte es etwa zwei Minuten bis sich der dichte Staub etwas gelichtet hatte und man auch ohne wildes Hupen sicher weiterfahren konnte. Bei etwa Kilometer 30 dieser Tortur passierte das, worauf ich schon zwei Monate gewartet hatte: Mein erster Reifenschaden. Ausgerechnet heute dachte ich mir. Aber was ist schon ein guter Zeitpunkt für eine Panne?
Glücklicherweise habe ich mir den Reifen nur an einem kleinen Metallsplitter aufgeschnitten, sodass genügend Luftdruck verblieb, um bei langsamer Fahrt die letzten 40 Kilometer bis nach Udomxai zurückzulegen. Bei jeder der winzigen Werkstätten war eine schauspielerische Meisterleistung gefragt, um ihnen verständlich zu machen, dass ich keinen Schlauch im Reifen habe und er daher nicht von der Felge genommen werden muss. Im fünften Laden hatte ich letztlich Glück. Nach einigen Hin und Her erkannte er das Problem und konnte meinen Reifen innerhalb von nur zwei Minuten flicken. Ich hatte sowieso schon geplant, mir in Chiang Mai ein Pannen-Reparatur-Set zu kaufen und werte diesen Zwischenfall als Weckruf und wertvollen Anschauungsunterricht zugleich.
In meinem Zeitplan hat mich dieser Zwischenfall eine wertvolle Stunde zurückgeworfen. Auf den 130 Kilometern nach Pak Beng musste ich also Tempo machen, durfte aber auf den Bergstrassen auch nicht übertreiben. Ein Sturz und schon ist der ganze Zeitgewinn – und womöglich meine weitere Reise – dahin. Um kurz nach 15 Uhr kam ich an der Fährstation an und hatte riesiges Glück. Eine fast voll beladene Autofähre hatte noch Platz für mich und setzte direkt zur Mekong Überquerung an. Das ersparte mir nicht nur gut 20 Minuten Wartezeit, sondern auch die klapprigen Holzstege der Motorradfähren, die für meine Suzuki schlichtweg zu klein sind.
Ich fasste neuen Mut und glaubte zum ersten Mal so wirklich, es schaffen zu können. Doch da hatte ich die Rechnung ohne die laotischen Grenzbeamten gemacht. Gegen 15:45 stand ich in Nam Ngeun an der Grenze zu Thailand, hatte bereits ausgestempelt und musste nur noch durch den Zoll. Eine Formalie dachte ich, da mich die Zollbeamten bei der Einreise einfach durchwinkten und weder Dokumente forderten noch ausstellten. Doch leider werden Bestimmungen in Laos offensichtlich nicht einheitlich umgesetzt. Mein freundlicher aber bestimmter Kontrolleur wollte auf Teufel komm raus irgendein Formular haben, das ich natürlich nicht vorweisen konnte. Ich redete ihm etwas gut zu, zeigte ihm nochmals meinen Pass und verkaufte ihm meinen Fahrzeugbrief als deutsches Importdokument. Das genügte ihm anscheinend, denn er gab mir direkt meinen Pass zurück und ließ mich ohne Beanstandungen nach Thailand ausreisen.
Dort ging es gleich wesentlich professioneller zu. Nach zwei Minuten war mein Pass gestempelt und in der Zollstation bat man mich in ein klimatisiertes Büro, um mir ein temporäres Importdokument auszustellen. Um 17 Uhr war ich endlich fertig, musste allerdings auch einsehen, dass ich meine ursprünglich geplante Route niemals vor Einbruch der Dunkelheit beenden würde. Und so entschied ich mich für eine alternative, kürzere Wegführung, die mich letztlich um kurz nach 18 Uhr und mehr als 10 Stunden Fahrt in ein luxuriöses – und erstaunlich günstiges – Hotel in Pua führte.
Für den nächsten Tag hatte ich mir mit der Garmin-Software BaseCamp eine fantastische 500 Kilometer Bergtour über winzige Strassen und Feldwege zusammengeschustert. Und so sass ich schon um 8:00 auf meiner Suzuki und fuhr eine kleine Bergstrasse in Richtung Westen, als diese plötzlich nach 35 Kilometern einfach endete. Mein Montana 600 zeigte die Strasse ab diesem Punkt als „unbefestigt“ an, was eine unzulässige Beschönigung ist. Schon die gut 200 Meter, die ich einsehen konnte, waren extrem steil, sandig und hatten tiefe Spurrinnen. Aus Laos hatte ich noch eindrücklich in Erinnerung, wie tückisch diese Mischung ist, weshalb ich direkt umdrehte und das Stück auf der Strasse 1148 umfuhr. Eine gute Entscheidung, wie sich schnell herausstellen sollte.
Fast ohne Gegenverkehr fuhr ich gute 1,5 Stunden durch traumaft bergige Landschaften. Eine Kurve reihte sich an die nächste, sodass man nie wirklich aus der Schräglage herauskam; ein Gefühl wie Skifahren bei besten Pistenbedingungen. Und das war nur der Anfang dieses überragenden Fahrtages! Ab da ging es non-stop auf Bergstrassen ca. 400 Kilometer direkt entlang der laotischen und später burmesischen Grenze. In den Steigungen wurde Kaffee und Tee angebaut, der dann in luxuriösen Resorts auf der Passhöhe verkauft wurde. Leider richtete sich das Angebot primär an wohlhabende thailändische Touristen und überstieg mein Budget bei Weitem. Und so begnügte ich mich mit den spektakulären Strassen und einer würzigen Nudelsuppe an einem kleinen Strassenstand.
Nach etwa sechs Stunden erreichte ich das Goldene Dreieck (Laos – Thailand – Myanmar) und setzte meinen Weg von dort entlang der burmesischen Grenze fort. Hier wurden die Bergpässe noch steiler, schmaler und verlassener. Es gibt eigentlich nur drei Gründe, diese winzigen Wege zu befahren: Man wohnt dort, man fährt die Strasse zum puren Vergnügen oder man schmuggelt. Dementsprechend stark war die Militärpräsenz in dieser Region. Alle 10-20 Kilometer musste ich an einem Militärcheckpoint halten, erklären, wohin ich unterwegs bin und z.T. Meinen Pass zücken.
Die Soldaten waren glücklicherweise durch die Bank sehr nett und ich passte offensichtlich nicht so recht in ihr Schmuggler-Profil, sodass sie mir zumeist nach zwei Minuten freundlich zulächelten und die Schranke öffneten. Ich konnte einfach nicht genug kriegen von diesen atemberaubenden Bergstrassen! Obwohl ich schon mehr als acht Stunden im Sattel sass, verlängerte ich die Etappe immer weiter, bis mich letztlich die untergehende Sonne wieder in erdnahe Sphären zurückholte.
Immer noch berauscht von der wilden Kurvenfahrt steuerte ich ein kleines Dorf an, in dem mich Feirns Familie zu sich nach Hause eingeladen hatte. Dort würde ich mich der nächsten Herausforderung stellen und mit Feirns Vater jagen gehen. Um kurz vor 18:00 Uhr erreichte ich das idyllisch gelegene Dorf lud mit den letzten Sonnenstrahlen mein Gepäck ab und wurde direkt mit einem Thai-Whiskey empfangen – besser geht’s nicht!
Nach einer schnellen Dusche hatte sich schon die gesamte Familie um einen reich gedeckten Tisch versammelt. Herrlich duftende nordthailändische Gerichte warteten auf mich: Schwein in frittierten Teeblättern, Salat aus Rindfleisch, Blut und Zwiebeln, verschiedene Suppen, Reis und natürlich mehr Thai-Whiskey. Es schmeckte herausragend gut! Müde, pappsatt, etwas beschwipst und überglücklich fiel ich schon um 21:00 Uhr ins Bett und schlief direkt wie ein Stein ein. Was für ein toller Start meines Thailand-Marathons! Wenn die weiteren Tage auch nur halb so schön werden, könnte das ein absolutes Highlight meiner Reise werden.