Und jeder hat sein ganz persönliches Juwel dabei entdeckt: Rekordfahrten auf den Bonneville Salt Flats, eine abgedrehte Nordkap-Tour, die Hommage an einen Ex-Kollegen oder der erste Test der legendären Ducati 750 SS – alles Sternstunden des Journalismus und Unterhaltung im besten Sinne. Eine spannende Zeitreise durch die faszinierende Zweirad-Lesewelt.
Die MOTORRAD-Redakteure Brigitte Haschek, Rolf Henniges, Thorsten Dentges, Thomas Schmieder, Peter Mayer, Stefan Kaschel, Ralf Schneider, Michael Schümann, Gerd Mayer, Gert Thöle, Berit Horenburg, Markus Biebricher, Jörg Lohse und Gerhard Eirich berichten von ihren spannendsten Erlebnissen.
Brigitte Haschek
„Quatsch“, knurrte Limmert. „Ein Journalist muss nicht verpacken, sondern auspacken.“ und Limmert, der Sturkopf, packte aus".
Die Mütze ist sein Markenzeichen. Ebenso wie die selbst gedrehten Zigaretten im Mundwinkel und die schwarze Lederjacke. Die junge Redakteurin Brigitte Haschek ist schwer beeindruckt, als sie den damals schon reiferen Kollegen Mitte der 80er-Jahre trifft: Lebenslustig, willensstark, unangepasst, individuell und manchmal ein bisschen kauzig – so ließe sich der Charakter der Marke Limmert vom ersten Eindruck her beschreiben.
Und dann viele Jahre später, als man sich besser kannte, dieses Abschiedsgeschenk von MOTORRAD-Mitstreiter Norbert Sorg zur letzten Schicht: ein Kabinettstückchen aus Anekdoten und punktueller Ausleuchtung von Peters Alter Ego – ohne den geringsten Hauch von Voyeurismus, dafür absolut authentisch. Chapeau, Herr Kollege.
Danke für diese treffende, feinfühlige und gleichwohl höchst amüsante Hommage an eine einzigartige Persönlichkeit und einen großartigen Journalisten. Dieses Limmert-Porträt hat gesessen wie eine maßgeschneiderte Kombi. Und ist auch heute noch absolut lesenswert.
Rolf Henniges

„Zwei Unterhosen, Shorts, ein T-Shirt, Wanderschuhe, Werkzeug, ein Sixpack. Das passt alles in einen Elefantenboy. Das genügt“
Intuitiv weiß man, wie es weitergeht. Autor Markus Schließ hämmert die Essenz der Lust am Motorradfahren in kurze, prägnante Zeilen. Banal gesagt, beschreibt er einen Tripp ins Elsass. Zwei Burschen, zwei italienische Bikes, zwei Tage frei.
„Die Ausfahrt“ ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Story Leidenschaft transportieren und übertragen kann. Wer sie damals las, rief anschließend sofort seine Kumpels an und fuhr los. Oder ärgerte sich, dass er sein Motorrad verkauft oder keinen guten Freund hat. Dennoch gab es damals keine begeisterten Leserbriefe zu dieser brillanten Story. Der Grund: Das schwarz-weiße Aufmacherfoto inmitten farbenfroher Geschichten rundherum in Verbindung mit einem wenig lyrischen Vorspann animierte damals nicht gerade zum Lesen. Wer sich nicht darum scherte und trotzdem las, bekam ganz großes Kino serviert. Kostprobe gefällig? „Erste Haarnadelkurve hoch zum Lochenpass, die Straße breit und frei. Die Pirellis sind warm, kein Zweifel. Das Vorderrad morst geschmeidigen Grip beim sanften Griff in den rechten Hebel. Axel ist wie immer dichtauf, ausgangs der Kurven sehe ich im Augenwinkel sein Vorderrad rotieren. Unbeschwerter Pas-de-deux, Ballett ohne Choreographie und dieses wohl uralte Gefühl, auf der Jagd zu sein. Herrlich. Alles löst sich auf in Zug und Druck.“ Die gesamte Geschichte wirkt wie mit Öl geschrieben. Sie ist eine Hommage an die Ur-Instinkte des Bikens. Mit allem, was dazugehört. Reifengrip, Schräglage, Pausenzigarette, Feierabend-Pils, Freundschaft und ganz viel Freiheitsgefühl. Markus Schließ schaffte es, den Leser als Sozius mitzunehmen.
Thorsten Dentges

„Sie heißt XL 1000 V und spricht als Vielzweckfahrzeug für Straße, Reise und leichtes Gelände den Fan an, der hohen Nutzwert mit Fahrspaß verbindet“
Es war 1998, die Fähre von Hamburg nach Newcastle hatte gerade abgelegt. Ich schlenderte zum Bordkiosk, um Reiselektüre zu kaufen. Dann die Offenbarung: Eine fast doppelseitige Illustration bildete die Reiseenduro meiner Träume ab. Die mutmaßliche Schwester der Africa Twin, da war sich Redakteur Axel Westphal seinerzeit sicher, sollte Honda XL 1000 V heißen und 1999 auf den Markt kommen.
Also keine Prototypen-Fiktion. Ich war hin und weg. Einspritzer-V2 mit 100 PS und Drehmoment-Ultrabreitband, wow! Und wie sie aussah: eine sexy Mischung aus Rallyemaschine und fettem Fun-Bike. Den Rest des Urlaubs interessierten mich mein Motorrad und Schottland, Wales und England nur noch wenig. Meine Sozia musste leiden, denn ich war kaum noch ansprechbar. Hatte nur noch im Kopf, wie ich möglichst schnell an Kohle kommen könnte. Bezifferte den Verkaufswert meiner XRV 750, rechnete zusammen, was Möbel und Stereoanlage einbringen würden, und plante Nebenjobs. Bohrinsel, Tag-und-Nacht-Taxifahren, auf dem Bau malochen, legal, illegal, scheißegal – Hauptsache Bares. An der Börse spekulieren, im Casino zocken, Tankstelle ausrauben? Keine Frage, ich wollte als Erster die neue Honda haben, dafür wäre ich über Leichen gegangen.
Wie es weiterging? 1999 kam tatsächlich eine neue Maschine auf den Markt. Sie hieß Varadero. Was dann allerdings vor mir stand, ließ mich schaudern: unansehnlich, übergewichtig, langweilig. Nach der Probefahrt blieb auch nicht die kleinste Spur Verliebtheit übrig, aus der Traum. Ich stieg wieder auf meine treue Africa Twin, und wir hatten bis 2005 die beste Motorradzeit meines Lebens. Das zerfledderte Heft mit der Zeichnung behielt ich trotzdem. Immer in der Hoffnung, dass Honda irgendwann doch noch die Vision von Technik-Zeichner Stefan Kraft in die Tat umsetzt. Diese Hoffnung habe ich bis heute nicht aufgegeben.
Thomas Schmieder
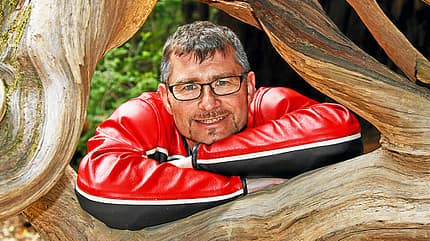
„Ich habe das Motorrad kaum auf den Hauptständer gezogen, als mich ein gutes dutzend brennend neugieriger Jugendlicher in grünen Uniformen umringt"
Mit dem Motorrad aus der Bundesrepublik offiziell in die DDR einzureisen, war bis zum 9. November 1989 unmöglich. Der Grund ist so einfach wie erschreckend: Die Delegationen beider deutscher Staaten hatten bei der Aushandlung des Verkehrsvertrags anno 1972 Zweiräder, egal ob mit oder ohne Motor, schlicht vergessen.
Doch es gab da ein Schlupfloch. In den Paragrafen, nicht im Eisernen Vorhang: Führte ein Transit nicht nach West-Berlin, sondern in einen dritten Staat wie etwa Schweden, Polen oder die damalige Tschechoslowakei, konnte man ein verlängertes Transitvisum für volle 72 Stunden beantragen. Von so einer Reise mit dem West-Motorrad BMW K 75 durch den Arbeiter-und-Bauern-Staat berichtete Christoph Altmann 1987. Dieser DDR-Trip inspirierte mich zu einem spontanen Abstecher vom Sommerurlaub 1988 in Schweden zu den Verwandten nach Dresden. Dort war nicht nur die deutsch-deutsche Wiedersehensfreude bei der Familie groß. Sondern auch das Staunen über die 98 PS starke Yamaha XJ 900 N zwischen lauter Zweitakt-MZ. Danke für dieses unvergessliche Erlebnis.
Peter Mayer

„Noch viele Tage lang verstopfen unzählige Radsport-Enthusiasten die berühmten Pässe. Was dafür entschädigt: Wir waren dabei“
Es war angeblich das größte Sport-Event aller Zeiten: Rund eine Million Menschen sollen am 21. Juli 2004 zum Bergzeitfahren nach L’Alpe d’Huez gepilgert sein – und MOTORRAD war mittendrin. Zu Hause in der Redaktion hat das zunächst keiner geglaubt, auch mancher Leser hielt den Aufmacher für eine Fotomontage. Aber es war genau so: Es keimte damals die Idee, einen Konzeptvergleich auf den Spuren der Tour de France zu machen, die Strecke also nachzufahren. Redakteur Gert Thöle, dessen journalistische Laufbahn bei einer Fahrrad-Zeitschrift begann, genügte das nicht: „Ich fahr da mitten rein, und zwar zum Bergzeitfahren nach L’Alpe d’Huez.“ Ein verwegener Plan. Es wurden Menschenmassen erwartet, weil es das erste und bisher einzige Zeitfahren auf dieser legendären Etappe war. 13,8 km, 21 Kehren, acht Prozent Steigung, 1080 Höhenmeter. Das Duell Jan Ullrich gegen Lance Armstrong kochte auf dem Siedepunkt.
Doch nur wer wagt, gewinnt. So brach eine Gruppe von fünf Fahrern plus Fotograf nach Südfrankreich auf und traf am Tag vor der Austragung am Fuße der legendären Bergetappe ein. Weiträumig war alles abgesperrt, da gab es scheinbar kein Durchkommen. Ein Einheimischer gab den entscheidenden Tipp, dass man eventuell noch hintenrum über Villard-Recolas nach Huez, ungefähr auf der Mitte des Anstiegs liegend, durchkäme. Irgendwie schaffte es das MOTORRAD-Team dann auch, Kontrollen und Sperren zu umgehen, am späten Abend konnte man sich einen halben Kilometer unterhalb von Huez ein paar freie Quadratmeter als Zeltplatz auf der Straße sichern. Nachts rumpelten auf der freien Spur schwere Sattelschlepper vorbei.
Am frühen Morgen ging dann der Rummel los. Hunderttausende von Menschen strömten den Berg hinauf. Und dann der Start, die Fans flippten aus. Die gesamte Strecke war prallvoll mit Menschen, die immer nur für die Fahrer kurz eine schmale Gasse öffneten. Ganz zum Schluss dann mit unglaublichem Speed die Top-Stars. Erst Jan Ullrich mit dem typischen langsamen Tritt. Und als Letzter dann Lance Armstrong im unwiderstehlichen Wiegetritt. Beide passierten die in Reihe aufgestellten Testmaschinen im Abstand von wenigen Zentimetern, Fotograf Dave Schahl hielt diese Momente für die Ewigkeit fest.
Stefan Kaschel

„Für die meisten ist Erwin Eimermann ein liebenswerter Kauz, doch einigen stinkt sein unkonventionelles Auftreten gewaltig“
Wenn ich mich heute an das Porträt von Erwin Eimermann erinnere, ja selbst wenn ich es noch einmal lese, fällt es mir nicht ganz leicht, zu sagen, was genau an dieser Geschichte mich so bewegt. Es ist jedenfalls nicht der Gespann-Sport. Der stand schon damals nicht im Mittelpunkt des Interesses. Und erst recht nicht in dem des Autors Klaus Herder.
Was aber dann? Der Mensch Erwin Eimermann? Auch das liest man bei Herder nicht umgehend heraus. Distanziert
beschreibt der Autor seinen Protagonisten und die erbärmlichen Umstände, unter denen Eimermann seinen Sport betreibt. „Im Wohnbereich des Seelenverkäufers sorgt ein Küchentisch mit Resopalplatte, eine durchgesessene Polstergruppe und großflächig verarbeitetes Kiefer-Furnier für so etwas wie Gemütlichkeit. Im mittleren Teil des Fahrzeugs liegt Erwins 90-jährige Mutter. Die alte Frau ist ein schwerer Pflegefall und muss rund um die Uhr betreut werden. Erwin macht aus der Not eine Tugend und nimmt sie immer mit auf Rennen“, stellt Herder nüchtern fest.
Vermutlich ist es genau dieser Abstand, der mir diese Geschichte so nahebringt. Ein Aufmacher zeigt Eimermann, wie er sein zerschreddertes Gespann wieder einmal vorzeitig einpackt, ganz routiniert. Erwin lacht sogar dabei, trinkt ein Bier. Auf der folgenden Seite eine Windel, irgendwo im Kiel des Renngespanns. „Improvisieren: Windel als Naßsumpf“, beobachtet Herder. Man ahnt: Es handelt sich um die Windeln für seine Mutter. Und genau das ist die Stelle, an der sie erwacht, meine tief empfundene Sympathie für Erwin Eimermann. Den Underdog, den Verlierer, den Idealisten, der Rennsport um des Rennsport willens betreibt, und nicht, um zu gewinnen. Man macht sich Gedanken darüber, wie Eimermann, während alle anderen die Heizdecken von ihren Reifen ziehen, kurz noch seine Mutter versorgt. Und wie unmöglich sein Unterfangen ist, beides unter einen Hut zu bringen. „Der absolute Tiefpunkt folgte 1994“, schreibt Herder. „Bei acht Rennen kam Erwin kein einziges Mal ins Ziel.“ Danach eine Liste der Ausfälle der 96er-Saison. Beifahrer verloren, Pleuel abgerissen, Hinterrad verloren, Batterie kaputt, Zündung malad. Doch egal, was passiert: Eimermann lässt sich nicht unterkriegen, lacht auf allen Bildern, hat gute Laune.
Die hat diesem Anti-Helden scheinbar nicht einmal ein Schreiben der IGG, der Interessengemeinschaft der Renn-Gespannfahrer, an MOTORRAD verdorben. Das Schreiben ist ebenfalls abgedruckt. Die IGG distanziert sich von Eimermann, von seinem Auftritt im Fahrerlager, dem Zustand seines Gefährts, von seinem Fahrstil. Der Erwin sei ein netter Kerl, schade aber dem Ansehen dieser Sportart. Das ist dann endgültig der Punkt, der diese Geschichte für mich so unvergessen macht. Sie forderte eine Entscheidung von mir. Für Eimermann, für seine Leidenschaft – und gegen die IGG und ihr Bestreben um das Image des Gespann-Rennsports. Eine Entscheidung, die ich gern getroffen habe.
Ralf Schneider

„Vor den improvisierten Boxen, die wie eine Theaterkulisse zusammengenagelt und nur durch Strohballen voneinander getrennt sind, brüllen 50 Motorräder. Ihr Getöse hallt wider von den Mauern der Stadt“
Ein Langstreckenrennen auf einer lebensgefährlichen Strecke und eine orgiastische Party rings umher, ja sogar mittendrin. Begeisterte Fans und eine Rennleitung, die einen Ausfall der Zeitnahme-Anlage nutzt, um Ergebnisse zu manipulieren. Todesnähe und Lebenslust, Naivität und Bosheit – zwischen diesen Extremen bewegt sich Friedemann Kirns Reportage von der 1984er-Ausgabe des 24-Stunden-Rennens im Montjuïc-Park in Barcelona. Der Autor hat eine packende und faszinierende Mischung aus Informationen und Impressionen zusammengestellt. Man ist mittendrin und stets dabei, schwankt zwischen Schauder und Ehrfurcht. Ich bin einerseits froh darüber, dass es dieses wahnsinnige Rennen nicht mehr gibt. Aber ich finde es andererseits schade, dass es keinen Stoff für solche Reportagen mehr liefert.
Michael Schümann

„Ich kann sofort anfangen. Umtopfen, aus- und einräumen. Der Lohn: Ein Nachtlager im Gewächshaus sowie ein üppiges Abendessen im Kreis der Familie“
Es war im Juni 2002, mitten während der Fußball-WM. Im Endspiel schlug Brasilien Deutschland 2:0. Aber das war Rolf Henniges, damals gerade 33 Jahre alt und nach einer Auszeit in Australien noch neu in der MOTORRAD-Mannschaft, völlig wurscht. Er war losgefahren, um einen Selbsterfahrungstrip zu erleben – und anschließend eine seiner besten MOTORRAD-Reportagen darüber zu schreiben. Mit einer MZ SX 125, einem Schaffell auf dem Sattel und nur zwei Euro in der Tasche 1200 Kilometer quer durch Deutschland. Auf den Alu-Koffern für jedermann gut lesbar: „Kein Geld. ARBEITE gegen Essen, Trinken, Schlafen, Tanken“ – das war mutig. Und es war, zumindest für mich, der erste Meilenstein auf dem langen Weg des Kollegen vom kauzigen Kahlkopf zum Kult-Schreiber.
In kurzen, knackigen Sätzen skizzierte er auf satten 13 Seiten seine Erlebnisse, Begegnungen und Lehren aus jenen arbeitsintensiven sieben Tagen. An reichlich Frust ließ er seine Leser genauso teilhaben wie an der Lust, mit der er loslegte, wenn sich doch immer wieder jemand seiner erbarmte. Egal, ob hessische Provinz oder sächsisches Land, jeden Tag aufs Neue ging erst lange nichts. Überall biss er mit seiner Fragerei nach Arbeit auf Granit, wurde schief angeschaut, für einen Penner gehalten oder für irre und potenziell gefährlich.
Bis er ans Aufgeben dachte. Und überall ging dann doch wieder irgendwas: Brennnessel-Böschung sensen, Walderdbeeren pflücken, Stall ausmisten, Brennholz spalten, Decke streichen, Orchideen umtopfen, Rindenmulch schaufeln, kellnern, Küche putzen, Ritterrüstung polieren, Kofferraum aussaugen, katholische Handzettel falten. Henniges war sich für nix zu schade. Wer ihn kennt, weiß, dass das seinem tatsächlichen Wesen auch wirklich entspricht.
Warum mir ausgerechnet diese Story so im Gedächtnis geblieben ist? Ganz einfach: weil ich mir selbst die Idee dazu nicht zutrauen würde. Und die Ausführung gleich dreimal nicht. Weil die Geschichte so gnadenlos ehrlich ist. Weil sie voller Wortspiele steckt. Und weil Henniges’ Optimismus immer über den ihm genauso eigenen Pessimismus triumphiert. Eine echte Geschichte aus dem Leben.
Gerd Mayer

„Das Ziel ist das Ziel: ein eiserner Globus auf einer Landzunge in der Barentssee, das Nordkap“
Die absolute Traumreise, da musst du dabei sein.“ Kollege Dentges leistet engagiert Überzeugungsarbeit. Er schwärmt von nie endenden Mittsommernächten, von grandiosen Landschaften und von skandinavischen Grazien. „Du willst doch nicht die ganze Zeit nur vor dem Grafik-Bildschirm hocken, oder?“ Damit trifft er den wunden Punkt. Ich muss mal raus, egal wohin. Was es tatsächlich bedeutet, in 72 Stunden von Hamburg aus mit 125ern ans Nordkap zu heizen, ist mir da allerdings noch nicht klar.
Es wird eine Tortur: Die versprochenen grandiosen Landschaften verschwimmen im Verlauf dieser Wahnsinnsfahrt zu eintönigen, immer gleichen Landstrichen. Kein Wunder, bei Tagesetappen von über 1000 Kilometern und bis zu 15 Stunden im Sattel. Auch die norwegischen Mädels enttäuschen mich, denn die größten Energiereserven des Landes scheinen in deren Hüftspeck zu lagern. Als wir das Nordkap dank günstiger Witterung und tapferer Mopeds tatsächlich rechtzeitig erreichen, fühle ich mich wie ein Weltmeister. Das muss gefeiert werden! Doch die Dame an der Supermarktkasse verweist auf die Gesetzeslage: kein Alkoholverkauf nach 19 Uhr. Mein Zeitmesser zeigt vier Minuten nach sieben. Also müssen die letzten Reserven des Reiseproviants reichen, um den Erfolg zu begießen: ein Schnapsglas Pastis für drei Männer.
Letztendlich habe ich jede Sekunde dieses Höllenritts genossen. Diese Reise wird mir immer in Erinnerung bleiben.
Gert Thöle

„Hinter der Winz-Verkleidung merkt der Fahrer vom Fahrtwind kaum etwas. Unterschätzung der Geschwindigkeit wird damit, eher als einem lieb ist, zum Problem mit Konsequenzen“
Dass kleine Zufälle, zunächst eher nebensächlich erscheinende Begebenheiten, den Lebensweg entscheidend beeinflussen, davon können ja viele Menschen erzählen, wenn sie später einmal auf ihr Leben zurückblicken. Auch bei mir war das so. Irgendwann im Sommer 1975 bekam ich eine MOTORRAD-Ausgabe mit dem ersten Test der Ducati 750 SS in die Finger. Ich war gerade 18, das Thema Motorrad war von Haus aus tabu. Umso stärker der Wunsch nach solch einem unerfüllbar erscheinenden Traum. Ich habe diesen Test damals aufgesogen, verschlungen, er hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Dass gerade eine entscheidende Weiche für mein ganzes Leben gestellt wurde, war mir nicht klar.
Aber das Thema Motorrad war von da an in meinem Kopf, speziell die Faszination für Ducati-Motorräder. Ich hatte Hochachtung vor den Leuten, die solche Tests machen durften. Redakteur Peter Limmert, der diesen Bericht schrieb, war für mich damals ein Held, den man bewunderte und beneidete. Selbst einmal dieses Privileg zu genießen – kein Gedanke. Zeitsprung: 1992 besitze ich längst meine Traummaschine, eine Königswellen-Ducati 750 SS, bin selbst MOTORRAD-Redakteur. Mein Kollege ist jener Peter Limmert, mit dem ich bis zu seinem Ruhestand ein paar Jahre zusammenarbeiten durfte. Und das alles nur, weil mich damals Limmerts Test und die Ducati 750 SS so begeisterten. Im Nachhinein betrachtet doch eine ziemlich verrückte Story, oder?
Berit Horenburg

„Es geht so überraschend stark bergauf, dass ich volle Lunge mittreten Muss. Der Puls steigt – die Geschwindigkeit sinkt rapide“
Eine geniale Idee, die Peter Limmert 1979 hatte. Mit einer Velosolex um die Nordschleife fahren. Eine Geschichte über Entschleunigung, bevor das Modewort überhaupt aufkam. Und eine Geschichte, in der der Autor sympathisierend über Rennfahrer spöttelt. Gleich bei der Ticketausgabe für die Runde wettet er, dass er die 22,83 Kilometer in einer Stunde schafft. Das ist mutig. Der Reibrollenmotor, der das Vorderrad antreibt, verhilft der Velosolex auf gerader Strecke mit 0,57 PS zu 24 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Nordschleife hat aber auch noch 280 Meter Höhenunterschied und hinauf zur Hohen Acht fünf Kilometer Steigung mit 17 Prozent.
Bergauf muss der Kettenraucher Peter Limmert also kräftig treten, was ihm den Atem raubt. Auch kommt er mit dem „stark kopflastigen Velo“ vom „sicheren Pfad der Ideallinie“ ab. Dabei gerät das Moped so stark ins Pendeln, dass „selbst friedliche Autofahrer neben der Lichthupe jetzt auch das Dreiklanghorn gebrauchen“. Und ihm mit auf den Weg geben, das sei „schließlich eine Rennstrecke und kein Radweg“. Als stehendes Hindernis auf der Nordschleife braucht der Mofa-Pilot auf alle Fälle trockenen Humor: „In der Fuchsröhre – ich habe jetzt fast 40 km/h drauf – merke ich, daß die Ideallinie für alle da ist – theoretisch. Praktischer ist es, den mit über zweihundert Sachen in das Nadelöhr hineinpolternden Reifen-Testwagen Platz zu machen.“
Immer wieder misst Peter Limmert in einzelnen Streckenabschnitten die Zeit, die er braucht. Vergleicht sie mit Zeiten von Sprintern oder Radfahrern und kommt natürlich jedes Mal besser weg. Oft muss er ausweichen, bevor er nach rund 68
Minuten das Ziel erreicht. Wette verloren – aber Spaß gehabt. Dafür bekommt er eine Radlermaß spendiert. Was ihm recht gewesen sein dürfte.
Markus Biebricher

„Weil es die Geschwindigkeit gibt, braucht es nichts anderes“
Mitten auf der Salzfläche, über die sich ein Himmel spannt, der so weit reicht, als wolle er das gesamte Universum umfassen, liegt das Fahrerlager der International Motorcycle Speed Trials. Spätestens um zehn ist es so hell, dass das Licht als weißer Schmerz ins Auge sticht. Und es ist so heiß, dass man am Tag vier Liter trinken kann, ohne einen Tropfen pinkeln zu müssen. In der Hitze verschwimmen die Konturen entfernter Dinge wie auf einem zittrigen Fernsehbild. Es gäbe an diesem Ort nichts, wenn es nicht die Geschwindigkeit gäbe. Doch weil es die Geschwindigkeit gibt, braucht es nichts anderes.“
Mit diesem szenischen Bild lässt Michael Orth seine Geschichte beginnen. Eine Geschichte über die Sehnsucht nach Geschwindigkeit, über die Suche der Motorradfahrer nach Grenzen. Die Klarheit und Intensität der Gefühle beim Schnellfahren und den Suchtfaktor, der das Phänomen Beschleunigung und Geschwindigkeit immer wieder begleitet. Diejenigen, die mit ihren Maschinen auf Rekordjagd gehen, sprechen von einem fantastischen Gefühl, von Schönheit, von einem Stück eigenem Universum, vom Einssein mit dem Motorrad, sich selbst, dem Himmel und dem Salz, das sich ständig verändert, nie dasselbe ist.
Michael Orths Sprache ist intensiv und philosophisch. Er beschreibt die skurrilen Figuren, die sich hier verwirklichen wollen. Die Bilder unterstützen seine Sprache, fangen die Stimmung ein, zeigen einen Typen, der zwei Zigaretten gleichzeitig raucht. Zeigen Menschen, die auf dem neun Meilen langen Salzkurs nicht nur ihre Maschinen, sondern auch ihre Herzen rasen lassen. „Wenn du spürst, dass dich die Geschwindigkeit in Besitz nimmt und sich vor dir diese riesige weiße Fläche auftut, dann ist es unendlich schwer, wieder langsam zu machen. Du bist erfüllt von einer Art Frieden. Es nimmt dir den Atem“, sagt einer.
In dieser Geschichte geben die Menschen für ein paar Sekunden alles, verlieren sich in der Geschwindigkeit. Es sind Menschen, die Leidenschaft leben, gegen alle Widerstände Berge versetzen, die das Leben und die Natur respektieren.
Jörg Lohse

„Alle drehen sich zu einer Person um, die gerade das lauschige Gartenrestaurant betreten hat: es ist Marco Simoncelli, im Arm hält er seine Freundin Kate“
Es gibt Bilder, die vergisst man nicht. Eines davon ist das MotoGP-Rennen von Malaysia im Jahr 2011, als Marco Simoncelli stürzt. Direkt vor Valentino Rossi und Colin Edwards, die beide nicht mehr ausweichen können. Der Helm, der von seinem charismatischen Lockenkopf förmlich weggesprengt wird.
Wenige Wochen vor diesem Ereignis kam Kollege Rainer Froberg mit leuchtenden Augen aus Italien zurück: Von der „Italian Legendary Tour“, eine bis dahin jährlich stattfindende Promotionaktion der Bekleidungsmarke Dainese, die aber eher eine Werbeveranstaltung für das Motorrad war. Unzählige Biker aus aller Welt, die das Losglück beim Kauf einer Kombi oder eines Helms zusammengespült hatte und durch schöne Landschaften kurven ließ. Als Sahnehäubchen begleitet von Tourguides, die man sonst nur aus dem TV oder gar von historischen Rennbildern kennt: Max Biaggi, Valentino Rossi, Kevin Schwantz, Carl Fogarty oder Italiens Volksheld Giacomo Agostini.
Die sorgten natürlich bei jedem Tankstopp oder jeder Ortsdurchfahrt für kleine Menschenaufläufe. 2009 begleitet Simoncelli für einen Tag den Corso. Den Paradiesvogel, den man aus der Boxengasse kennt, lernt Rainer, der im Auftrag der Redaktion die Tour mitfährt, nicht kennen. Dafür einen Motorradfahrer, der mit breitem Grinsen durch die oberitalienische Seenlandschaft kurvt, seine Freundin Kate auf dem Soziusplatz. Und mit dem man sich am Ausklang eines langen Tages auf dem Bike in einer Trattoria zuprostet. Wenige Wochen später stirbt der charismatische Rennfahrer auf dem Rundkurs in Sepang. Die Reportage über die „Italian Legendary Tour“ musste deshalb eine Hommage an die Nr. 58 des Motorradrennsports werden. Und eine Geschichte, die ich nie vergessen werde.
Gerhard Eirich

Als MOTORRAD Classic-Mann stöbert man zwangsläufig in Archiven, wenn auch nicht jeden Tag in den ganz frühen Jahrgängen von MOTORRAD. Eine einzige Geschichte aus den frühen Tagen exemplarisch auszuwählen, fiele mir schwer. Artikel waren damals anders, es zählte weniger der Unterhaltungswert als der manchmal etwas spröde aufbereitete Informationsgehalt. Bleiwüsten inklusive – Bilder standen weniger im Vordergrund als heute. Vielmehr finde ich es nach wie vor faszinierend, wie sich die Titelseiten im Laufe der Jahrzehnte gewandelt haben und zumindest tendenziell das Lebensgefühl der Zeit widerspiegeln.
Auch die Tatsache, dass der Titel in den 20er-Jahren über lange Zeit immer dasselbe Motiv zeigt, ist ja eine Aussage in sich: Der Inhalt zählt, das Heft muss wiedererkennbar sein. Das ändert sich in den 30er-Jahren – die einsetzende Massenmotorisierung und die wachsende Bedeutung des Zweirads zeigen, dass das Motorrad in der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Alltagsmotive mit Tankstellen-Situationen auf dem Titel scheinen dies belegen zu wollen. Die 40er-Jahre sind, zumindest in der ersten Hälfte, vom Zweiten Weltkrieg geprägt. Auch dies geht nicht spurlos an den Titeln vorüber. Kradmelder, Militärmotive sind kein Tabu, das Motorrad hat eben auch seine Funktion in der Kriegsmaschinerie.
Die zunehmende Entspannung, der Optimismus beim Wiederaufbau, das beginnende Wirtschaftswunder in den 50er-Jahren führen zu einer Art kleinen Euphorie, die sich in zahlreichen scherzhaften Illustrationen niederschlägt. Die neue Lockerheit, ja fast schon Albernheit greift um sich. Und schließlich komme ich an einem Heft von 1969 nicht vorbei, das ein Motorrad auf dem Titel zeigt, das seine Faszination bis heute bewahrt hat und die Zweiradwelt sicher am nachhaltigsten beeinflusst hat: ein japanisches Vierzylinder-Bike namens Honda CB 750 Four. Der Aufbruch in die Neuzeit.





