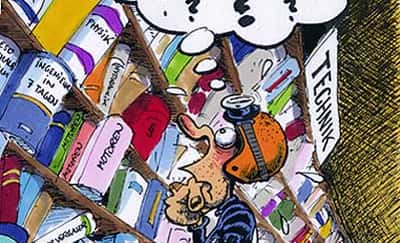Warum Motorradfahrer das Denken am besten bleiben lassen sollten
Über die Welt ließe sich sagen, dass sie völlig uninteressant wäre, wenn es auf ihr keine Geheimnisse gäbe. Über die Welt ließe sich weiterhin sagen, dass selbst hinter Dingen und Sachverhalten, die kein Mensch mehr hinterfragt, Geheimnisse sich verbergen. Weswegen letztlich alles interessant ist auf der Welt. Wie
das glauben Sie nicht? Bitte sehr. Warum fällt der Apfel vom Baum und fliegt nicht
zum Mond? Wieso ist die Banane krumm? Was bewegt Menschen, in Bettwäsche mit den Insignien des FC Bayern München zu schlafen? Weshalb blockieren Räder beim Bremsen, und was kann man dagegen tun?
Bereits die Antworten auf die ersten drei Fragen klingen mindestens ebenso vertrackt wie banal. So fliegt der Apfel nicht zum Mond, weil er eine gewisse
Masse und, was damit zusammenhängt, die Erde eine penetrante Anziehungskraft besitzt, weswegen der Australier nicht von Australien, sondern der Apfel vom Baum fällt; die Banane wiederum macht sich krumm, damit sie in ihre Schale passt; und
Menschen gibts, die unterstützen den FC Bayern sogar im Schlaf, weil sie hoffen, wenigstens einmal in der Woche nicht als Verlierer aufstehen zu müssen.
Darüber nachdenken, was passiert, wenn ein Motorrad brutal abgebremst
werden muss, sollte man eigentlich nicht. Doch vielleicht sollte man darüber nachdenken, warum man nicht darüber nachdenken sollte. Zumal, wenn man gerade dabei ist, beim Bremsen. Dann ergeht
es dem Fahrer wie einem Pianisten,
der überlegt, welche Taste er als nächste
anschlagen muss. Es wird garantiert die falsche sein. Ein Musiker kann sich eine solche Blockade vielleicht erlauben, ein Motorradfahrer nicht.
Schon gar nicht, wenn ihm ein munteres Bäuerlein auf einem Traktor im Ernte-
stress die Vorfahrt nimmt. Rein in die Eisen, bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. So aber kanns passieren, dass die Räder blockieren, und wenn sie blockieren, lässt sich die Mühle nicht mehr dirigieren,
während sie mächtig nach vorn drückt. Also Bremse wieder auf, damit die Räder sich drehen, und dann wieder zu, auf dass
sie sich langsamer drehen. Dieser Prozess muss, im wahrsten Sinn des Wortes, besinnungslos vonstatten gehen. Wer dabei denkt, sinniert: Soll oder soll ich nicht?
hat schon verloren. Weshalb es mitunter sehr wohl angebracht wäre, dem Motorradfahrer das Denken abzugewöhnen, per Antiblockiersystem, per ABS.
Blockieren, das ist, so könnte man
sagen, die extremste und ungesündeste Form des Bremsens. Weil Bremsen notabene stets darauf hinausläuft, dass das Rad immer weniger oft rotiert. Unabhängig von ihrer Ausführung mit Trommel oder Scheibe funktioniert eine Bremse nach dem Prinzip, dass ein mit dem Rad mit-
laufendes Teil Druck bekommt von einem
anderen, das sich diesem rotierenden
System gleichsam aufdrängt, von außen. Und Bewegungsenergie in Wärme umwandelt. Wird dieser Druck jedoch zu groß, steht das Rad auf einmal still.
Das Motorrad ist nun mal ein hin-
fälliges Konstrukt
Ein Reifen, der läuft, geht mit dem
Asphalt eine innige Beziehung ein, er verformt sich, krallt sich in den Belag. Mikroskopisch oder idealtypisch besehen, ähnelt diese Liaison dem Ineinandergreifen zweier verzahnter Oberflächen; der verformbare Gummi des Pneus presst sich in die gekörnte Struktur des Asphalts. Dabei entsteht Reibung, deren Wert davon abhängt, wie es um die Qualität von Gummi und
Asphalt steht. Und auch von dem Ge-
wicht, das auf der Reifenfläche lastet, dem »Latsch«, der den Asphalt kontaktiert. Dieses Ensemble von Kräften, das sich ständig verändert, und zwar mit fast jedem Regentropfen, wird mit der Haftreibungszahl µ quantifiziert, die eine Beziehung zwischen Brems- und Reifenaufstandskraft angibt. Was damit ausgedrückt werden soll, ist gemeinhin unter dem Namen Grip bekannt.
Bei blockierendem Rad verliert der
Reifen seine »Zähne«, seine Fähigkeit, sich in den Belag zu krallen. Anders als in einer festen Verbindung, steckt in einer Liaison, wo ein Partner lediglich stumpf und un-
beeinflussbar agiert, viel weniger Zusam-
menhalt. Indem das Rad rutscht, so dahin-
gleitet, weshalb man diesen Zustand auch Gleitreibung nennt, nimmt es die Sache mit der Haftung weniger genau. Wozu passt, dass es sich schwerlich führen lässt, wie es einem zupass käme, also am Traktor vorbei und nicht gen Häckselmaschine.
Denn ein Gefährt mit zwei Rädern in
einer Spur gilt als hinfälliges Konstrukt. Zu Recht. Was erklärt, warum es einen Ständer hat. Von der Gefahr des Kippens wird es erst durch sein Fortkommen, eine Bewegung mit nennenswerter Geschwindigkeit, befreit. Einmal in Gang gekommen, will die Fuhre letztlich immer nur das eine: stur geradeaus. Und je schneller es vorangeht, desto sturer stellt sich der Bock.
Diese Sturheit wiederum verleiht der Maschine Stabilität, die sofort wieder flöten geht, falls das Rad nur einige Zehntelsekunden blockiert, weil die Stabilität ja aus der Drehung des Rads resultiert. Dreht es sich nicht, wird ein Motorrad selbst bei hohem Tempo zum hinfälligen Konstrukt. Und dann hilft auch kein Ständer mehr.
warum es manchmal auf die äuSSeren Werte ankommt
Das Vermaledeite an der Blockade ist, dass der Fahrer beim Bremsen verdammt nah ran sollte an diese Grenze. Da muss das Rad sich nicht nur immer weniger oft drehen, es muss sich dramatisch weniger oft drehen. Gesetzt den Fall, ein Motorrad bringt in einer gewissen Zeit, der Zeit,
die ein Rad braucht, um sich frei laufend
zu drehen, zwei Meter hinter sich, muss sich das Rad, wenn es verzögert wird, auf
jeden Fall weniger als zwei Meter drehen
um sich selbst. Weil sonst, wenn alles
so weiterliefe wie bisher, keine Reibung entstünde. Käme ein ungehemmt sich bewegendes Rad bei einer Umdrehung zwei Meter weiter, wäre es dem Bremsen als solchen äußerst förderlich, wenn es in
dieser Zeit selbst gefälligst nur 1,80 Meter weit rotierte. Wobei die Hauptlast dieser Gefälligkeit der Reifen zu tragen hat, der
ordentlich durchgewalkt wird. Diese paar Zentimeter Unterschied zwischen Fahr- und Reifenumdrehungsgeschwindigkeit machen letztlich das Bemsen aus.
Die Maßzahl für die Relation von Fahr- und Reifenumdrehungsgeschwindigkeit hat man Schlupf genannt, und die mathematische Formel für dessen Berechnung erklärt sich eigentlich von selbst: Fahrgeschwindigkeit, 2 Meter pro Umdrehung, minus Radumfangsgeschwindigkeit, hier 1,80 Meter, geteilt durch die Fahrgeschwindigkeit, ergibt mit 0,2 geteilt durch 2 einen Schlupf von 0,1 oder, auch diese Angabe ist
gebräuchlich, von zehn Prozent. Blockiert das Rad total, schlupft sichs hoch auf
eins (2-0:2), bei ungehindertem Lauf gehts
runter auf null (2-2:2).
Mag sein, dass der Schlupf deswegen Schlupf heißt, weil er von der Schlüpfrigkeit des Untergrunds, der Straße abhängt.
Indem er nämlich eine Beziehung zwischen Fahrgeschwindigkeit und Umlaufgeschwindigkeit des Reifens angibt, benennt er
zugleich den Anteil der Gleitreibung während des Bremsvorgangs. Die elastischen »Zähne« von Reifen und Asphalt greifen
bei einem Schlupf von 20 Prozent noch
zu 80 Prozent. Was freilich nur in einer ganz bestimmten Situation tatsächlich bremsende Wirkung hat. Denn gesetzt den Fall,
diese Verzahnung muss als lockere an-
gesehen werden, was auf regennasser Straße leichthin passieren kann, können selbst zehn oder 20 Prozent Schlupf viel
zu wenig sein.
Da der Schlupf letztlich von der Haftreibung abhängt, also davon, in welcher Verfassung Straße und Reifen sich be-
finden, welche Kraft von hinten drückt
und welche Kraft dem qua Bremse ent-
gegenwirkt, heißt das im Umkehrschluss, dass sich aus dem Schlupf eine optimale Verzögerung bemessen lässt.
Es gilt das
zu praktizieren,
was gefälligst
zu vermeiden ist
Was nichts daran ändert, dass die Höhe des Schlupfs allein über den Erfolg einer Bremsung zunächst mal wenig aussagt, in etwa so viel wie der Alkoholge-
halt über die Qualität einer Flasche Wein. Doch auch diese Information kann schon eine Hilfe sein, wenn einer im Laden vor
einem Württemberger Trollinger mit zehn und einem Merlot aus Australien mit 14,5
Prozent steht. Wobei 14,5 Prozent beim Schlupf ebenso bekömmlich sein können wie deren zehn. Und tatsächlich verzö-
gert ein Motorrad in diesen Regionen am
effektivsten. Was jedoch noch fehlt, ist ein taugliches Instrument, das die Maschine auf eine verlässliche Art in diesen Bereich hineinbugsiert.
Folglich muss ein System, das ein
Blockieren der Räder vermeiden will, unabhängig von einem definierten Bereich
zu Werke gehen. Und das tut es dann auch, indem es bis zur Grenze geht, bis zum Blockieren halt. Ohne das zu prak-
tizieren, was es verhindern will, könnte
es, so besehen, gar nicht funktionieren. Und es funktioniert, indem es das macht,
was ein Motorradfahrer in dieser Situation ebenfalls machen sollte, sofort wieder auf. Und wieder zu und wieder auf. So schnell schafft es das bis zu siebenmal in einer Sekunde , dass die Gefahren, die von
einem blockierenden, einem stehenden Rad in Bewegung ausgehen, de facto nicht mehr existieren.
Weil das System stets im Grenzbereich agiert, ist es, von seiner inneren Logik her, völlig egal, wo genau jetzt dieser Grenz-
bereich liegt. Ebenso entspricht es seiner Logik, dass es prinzipiell Bremsweg verschenkt, wobei prinzipiell hier heißt: Ein optimaler Fahrer bremst ohne ABS besser. Weil er nämlich nicht immer wieder aufmachen muss. Dessen Art zu bremsen gleicht einer homogenen Kurve, die des ABS eher einer Zickzacklinie, rauf, runter, rauf runter. Andererseits fallen diese Zacken so minimal aus, dass fast ein jeder damit besser fährt. Allerdings nur geradeaus. Ansonsten muss er selbst die Kurve kriegen.
Warum ABS nicht die Kurve kriegt
Weil das Motorrad nicht freiwillig ums Eck fährt, muss der Fahrer es dazu zwingen, indem er sich samt Maschine in die Schräge bringt. Damit hebt er gleichsam die Kraft auf, die ihn stur geradeaus be-
fördern will, weswegen die Höhe der Kraft, die es braucht, das Motorrad von seiner trägen Vorwärtsbewegung abzubringen, von der Geschwindigkeit des bewegten Objekts und dem Radius der Kurve abhängt. Bei hohem Kurventempo kann es schon mal passieren, dass fast die ge-
samte Haftreibung für diese »Seitenführung« draufgeht. Und wo nichts ist, kann auch die Bremse nichts mehr holen, es sei
denn auf Kosten der Seitenführungskräfte. Werden die jedoch verringert, lässt die Schräglage nach. Weswegen ABS bei Kurvenfahrten kontraproduktiv wirkt, entweder richtet sich das Motorrad stumpf auf und fährt geradeaus weiter, oder der rasche Abbau der Seitenführung provoziert einen Sturz. Abhilfe könnte letztlich nur eine
Apparatur bringen, die Schräglagen misst, damit die Seitenführung taxiert und den also berechneten Rest der Reibkräfte fürs Bremsen optimiert.
Gibts aber noch nicht, so ein Wun-
derding. Deswegen muss ABS immer am
Limit agieren, und deshalb sind alle ABS-Systeme, egal von welchem Hersteller, nach ähnlichen Prinzipien aufgebaut. Ein Messinstrument am Rad, ein Sensor, ermittelt, wie schnell und wie gleichmäßig das Rad sich bewegt, diese Daten landen in einem Steuergerät, dessen Programme sich daran machen, diese Informationen
zu interpretieren und ihre Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Welche der Computer, sofern ihm verdächtige Unregelmäßigkeiten auffallen, die auf ein Blockieren hinweisen, sofort an das Bremssystem weitergibt. Auf dass dieses seinen Druck auf- und abbaue, die Bremse zu- oder
aufmache, und das gleich mehrmals in
der Sekunde.
Das hört sich zwar kompliziert und technisch aufwendig an, und das ist es auch, doch beruhen diese Vertracktheiten, wie so oft, auf relativ banalen Erkenntnissen. So besteht das Messgerät am Rad meist aus einem Magneten, der beim Starten der Maschine aktiviert wird und nicht mit dem Rad rotiert. An diesem Magneten, um den eine Spule gewickelt ist, läuft ein Zahnrad vorbei, das sich mit dem Rad
bewegt. Bei einer Zahnlücke wird das Magnetfeld schwächer, und die Spule wandelt diese Veränderung in einen elektrischen Impuls um. Dadurch entsteht eine Wechselspannung, deren Frequenz durch die Drehzahl des Rads bestimmt wird. Bei einem Zahnrad mit 100 Zacken erhält der Sensor bei einer Raddrehung 200 Infor-mationen, bei einer Geschwindigkeit von
200 km/h kommen immerhin zirka 5600 Impulse pro Sekunde zusammen. Genügend Stoff für die Steuereinheit, die frei-
lich erst dann reagiert, wenn sie sicher
ist, einen hinreichend abgesicherten Grund hierfür errechnet zu haben.
Warum man beim Driften das ABS
abschalten sollte
Den wichtigsten Hinweis auf einen eventuellen Einsatz können abrupte Änderungen der Raddrehzahl geben. Die treten jedoch genauso auf, wenn ein Rad über
einen Bitumenfleck fährt, was die Raddrehzahl steil nach unten jagt. Solche
Abweichungen registriert der Rechner
zwar, gleichsam im passiven Zustand des
Überwachungsbetriebs, reagiert aber nicht
darauf. So ein Rechner ist eben auch nur
eine Maschine, und obwohl sie dauernd läuft, greift sie erst dann entscheidend
ins Geschehen ein, wenn der Mensch
sie aktiviert. Indem er bremst, voll bremst. Wer das nicht kann, fährt eben unfreiwillig in die grüne Wiese oder sonstwo hin. Trotz ABS, denn das schaltet sich, weils nur
so funktioniert, erst dann ein, wenn die Fahrphysik an ihre Grenzen gelangt.
Manchmal auch schon davor. Weil das Motorradfahren nicht völlig berechenbar ist, was hier im eigentlichen Sinn des Wortes verstanden werden muss. Bei einem Drift zum Beispiel wird einem Rechner mehr zugemutet, als er momentan verkraften kann. Steigt das Hinterrad, dreht es sich nicht mehr, Schlupf 100 Prozent, konstatiert daraufhin die Maschine, höchste Gefahr, und leitet den Abbau des Bremsdrucks ein. Was völlig korrekt wäre, wenn der Fahrer so stark bremst, dass beinahe das ganze Gewicht der Maschine auf das Vorderrad drückt und die Gefahr droht, dass das Motorrad sich überschlägt. Falls das Rad jedoch abhebt aus Freude am Fahren, kann eine Reduktion der Bremskraft gefährlich werden.
Kuhfladen oder nicht Kuhfladen? das ist die Frage
Solche Eskapaden zu verarbeiten gehört natürlich nicht zu den obersten Pflichten eines ABS. Eher schon die: Einem
Fahrer kommt ein Traktor aus einem Seitenweg in die Quere. Worauf der Rechner vom Sensor am Rad die Information bekommt, dass die Raddrehzahl sich abrupt verringert. Indes bremst der Fahrer nicht so stark, dass die Räder zu blockieren
drohen: Die Schaltschwelle des ABS, die sich durch einen dramatischen Abfall der Raddrehung bestimmt, wird folglich nicht überschritten. Doch plötzlich gerät das Vorderrad auf eine glatte Stelle, die Gleit-reibung nimmt überhand, der Schlupf rast geradezu nach oben, das Rad droht zu blockieren. Jetzt ist der kritische Punkt, die Schaltschwelle erreicht. Weil der Rechner noch nicht wissen kann, was er eigentlich wissen muss, nämlich ob das Rad ledig-lich über einen Kuhfladen rutscht, filtert er
diese Daten. Ist er sich sicher, dass es sich um keinen Fehler im System und keinen kurzfristigen Ausrutscher handelt, gibt er an die Bremse zunächst mal den Befehl, den Druck zu halten und ihn auf keinen Fall zu erhöhen. In solchen Situationen zahlt
es sich aus, dass der Rechner mit Informationen über die Bewegung des Rads geradezu zugeschüttet wird. Bleibt der Wert auf seinem kritischen Niveau, leitet das Steuergerät nach wenigen Tausendstelsekunden einen Druckabbau ein, der Bremsdruck lässt nach, die Radgeschwindigkeit legt zu. Weil das fürs Bremsen bekanntermaßen äußerst kontraproduktiv ist, muss dieser Abbau schnell wieder gestoppt werden, und so macht das ABS eben wieder Druck. So geht das rauf und runter in
einem fort und mit einer wahnsinnigen
Geschwindigkeit. Bis die Fuhre endlich steht. Fast steht.
Was dabei an mechanischen, hydraulischen und elektronischen Prozessen abläuft, lesen Sie im nächsten Heft.
Bremsvorgang ohne ABS
Bremsen ist
das Gegenteil von
Beschleunigen,
weswegen es auch
unter dem Namen
Negativbeschleu-
nigung bekannt ist. Was beide weiterhin
verbindet ist, dass die
Geschwindigkeit des
Rades notabene nicht
mit der Geschwindigkeit des Vehikels selbst harmoniert. Was zu sehen
ist, auf der Zeichnung links (Kaffee) und auf der
Straße (Gummi). Größere Malheurs sind dabei nicht auszuschließen. Denn wenn beim Bremsen das Rad blockiert, herrscht akute Sturzgefahr.
Weshalb die Maschine
bei Fahrgeschwindigkeit null womöglich nicht steht, sondern liegt
Die Vorderbremse
Die Bremse vorne übernimmt fast die gesamte Verzögerung. Indem sie greift, übt sie eine Kraft (F1)
auf den Schwerpunkt aus, die abhängt von der Ver-
zögerung und der Lage des Schwerpunkts. Je höher
der liegt und je geringer der Radstand, desto anfälliger reagiert er auf Verände-
rungen des Kräftesystems
(dynamische Radlastver-
teilung), und desto schneller verlagert er sich nach vorne. Und indem er das tut, nimmt nicht nur die Kraft, die aufs Vorderrad drückt (Fv), sondern mit ihr auch die Bremskraft zu, was wiederum die Kraft auf den Schwerpunkt erhöht, worauf der noch
weiter nach vorne rückt. Und so weiter und so fort. Derweil sich hinten (Fh) immer weniger tut. Weswegen
bis zu 80 Prozent der Masse
auf dem Vorderrad lasten
Bremsregelung
Während die
Geschwindigkeit des
Motorrads gleich-
förmig nach unten geht, vollführt das Rad Kapriolen. Bei
Phase 2 schaltet sich das ABS ein. Blockiergefahr. Der Bremsdruck wird zunächst gehalten, das Rad also weiter verzögert. Noch größere
Blockiergefahr. Höchste
Zeit also, den Bremsdruck abzubauen (3), woraufhin
das Rad sich schneller
dreht, die Radumfangs-
geschwindigkeit dagegen weiter sinkt. Ein Paradox? Eigentlich nicht. Weil eine Masse in Bewegung fürchterlich träge ist. Noch ein Paradox? Eigentlich schon wieder nicht. Weil Trägheit hier das Verharren in einem Zustand meint. Einem Zustand, in dem das Motorrad rutscht, kurz vorm Blockieren ist. Es kann richtig Spaß machen, diese drei Kurven, Bremskraft, Radumfangs-
geschwindigkeit und Radumfangsbeschleunigung, in den einzelnen Phasen in Beziehung zueinander zu setzen
ABS-Systeme
ABS-Systeme können klassisch aufgebaut sein. Dann werden, wie beim »normalen« Bremsen auch, Vorder- und Hinter-
radbremse separat bedient.
Daneben gibt es Konstruktionen, mit denen über Handbremse wie Fußbremse vorne wie hinten gleicher-maßen verzögert wird
(Integralsystem). Rein
theoretisch müsste sich
die Funktionsweise des ABS auch fürs Beschleunigen nutzen lassen, weil beim Durchdrehen der Räder
ähnlich hohe Diskrepanzen bei der Raddrehzahl
auftreten. Die Hersteller
arbeiten daran, kamen
aber noch nicht zu Potte
ABS-Regelkreis
Die Impulsringe an den Rädern, Zahn-
räder meist, liefern die entscheidenden
Informationen. Näm-
lich, wie oft das Rad sich dreht. Da sie das mehrere tausendmal in der Sekunde machen, lässt sich auf-
grund der vielen Daten im elektronischen Steuergerät errechnen, ob das Rad
zu blockieren droht. Der Computer aktiviert dann die Modulatoren, hydraulische Systeme, oft mit Magnet-
ventil, die den Bremsdruck
der entsprechenden
Situation, dem jeweiligen Soll-Schlupf anpassen
Der Kammsche Kreis
In Kurven stößt das ABS an seine system-
immanenten Grenzen. Wie das zeigt der Kammsche Kreis. Der gibt die
Relation zwischen Kräften für Seiten- (Kurve) und Längsführung (Bremsen, Beschleunigen) an. Der
äußere Kreis entspricht dem Maximum bei trockener Fahrbahn, der mittlere dem bei Nässe. Wenn auf griffiger Straße 50 Prozent der möglichen Seitenkräfte
ausgenutzt werden, stehen immerhin noch 85 Prozent der möglichen Längskräfte zum Bremsen parat. Doch weil das ABS die Seiten-
kräfte nicht messen kann, scheitert es daran, die noch zur Verfügung stehende Bremskraft zu optimieren