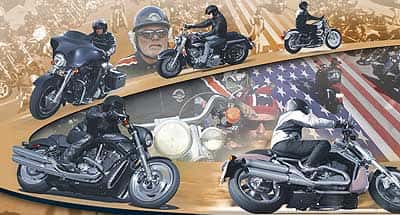Da gibts diese Story vom Tellerwäscher. Die glaubt halb Nordamerika, und irgendwie macht solch Glaube auch vor Managern nicht halt. Sonst wäre unerklärlich, warum ein paar leitende Angestellte sich tief verschulden und einem lustlosen Investor ihre eigene Firma abkaufen. Einen Laden, der mit renovierungswürdigen Produkten gegen mächtige Konkurrenz aus Japan antreten muss, dessen Vertriebsstrukturen rissig wirken und der mit Qualitätsproblemen kämpft.
Das Risiko scheint übermächtig, als die 13 Getreuen Mitte 1981 Harley-Davidson von AMF (American Machine and Foundry Company) übernehmen. Für 81 Millionen überwiegend geliehene Dollar. Unwahrscheinlich, dass sie fast alle zählen seit Jahren zu Harleys Führungsriege keine Job-Alternative besitzen. Nein, vermutlich beschwingt sie schon damals die unschlagbare Idee, ihre V-Twins als rollende Freiheitsstatuen zu vermarkten. Egal, mittlerweile steht fest, dass jeder zum Millionär mutierte Tellerwäscher neben den Milwaukee-Jungs wie ein Anfänger aussieht. Anders als im Märchen nämlich hören die Harley-Eigner nicht beim Glück auf, sondern durchdringen ihren Markt, verbessern die Produkte, feilen am Mythos, gründen eine ganz neue Harley-Gemeinde. Und erklären ihre Firma zur nationalen Sache: 1983 erhebt die US-Regierung auf Betreiben der Company Zölle gegen alle japanischen Motorräder über 700 Kubikzentimeter. Freundlicherweise erbietet sich die Big-Twin-Schmiede schon nach vier Jahren, auf diese Art Wettbewerbsverzerrung verzichten zu wollen. Doch wer weiß, wie sie die Motorradkrise von 1983/84 die erste seit dem 60er-Jahre-Boom ohne Staatshilfe überstanden hätte?
Gegen Ende der 70er Jahre hatte AMF den Output auf gut 70000 Stück angehoben. Und damit Qualitätsprobleme am laufenden Band produziert. 1981 heißt die Devise: Qualität hoch, Kosten runter. Ab 30000 Einheiten soll Geld verdient werden. Der Plan gelingt, ganz allmählich steigert Harley die Produktion. Und leistet fröhlich ideelle Vorarbeit für größere Volumina; die Legende wird aufgearbeitet,
findet neue Adressaten, höchst engagiert webt sich die Firma in das Beziehungsgeflecht ihrer Kunden ein. Mit der Harley Owners Group (H.O.G) gründet sie gar den mit heute über 900000 Mitgliedern stärksten Biker-Club der Welt. Als Resultat dieser mythischen Aufrüstung gibts jahrelang weniger neue Harleys als zahlungswillige Kunden. Mit entsprechenden Verzerrungen auf dem Gebrauchtmarkt sowie abenteuerlichen Grauimporten.
Alle Beteiligten gewöhnen sich rasch an enorme Steigerungsraten bei Umsatz, Produktion und Gewinn. 1994 entlassen die Amis runde 94000 Motorräder in
die Freiheit, elf Jahre später sinds über 329000. Der Nettoumsatz wächst im selben Zeitraum von 1,2 Milliarden auf über 5,3 Milliarden Dollar, der Gewinn von 96 auf 959 Millionen*. Armer Tellerwäscher. Angesichts dieser Zahlen wird verständlich, warum Aktionäre in Panik geraten, als das Management die Absatz- und damit auch die Gewinnerwartungen im Lauf des Jahres 2005 nach unten korrigiert. Das Papier tut, was es seit 1986, dem Jahr seiner Börsen-Wiedereinführung, noch nie getan hat: Es fällt. Und einige Aktionäre konfrontieren Harley mit einer unangenehmen Klage. Dabei wars falscher Alarm, 2005 fuhren die V-Twins zum 20. Mal in Folge Rekordergebnisse ein.
Europa nimmt die schiere Größe der Company kaum wahr; umgedreht frage mal jemand die Amis, ob sie Triumph oder Ducati wichtig finden. Jeder zentriert sich eben, so gut er kann. Dabei verkaufen
die Nachfolger des Harley und der Davidsons auf unserem Kontinent beinahe je-
des Zehnte ihrer Motorräder. Macht rund
30000 Stück. Jährlich. Kanada, Japan und die anderen kriegen acht Prozent vom
Output. Und der schlappe Rest? Nun, über 250000 Milwaukee-Eisen verweilen dort, wo sie am besten funktionieren, auf Gods own highways in Gods own country. Dagegen kommt nicht mal Honda an: Bei
Motorrädern über 650 Kubikzentimetern hält der Weltmarkführer in Nordamerika
einen Anteil von rund 19 Prozent, Harley-Davidson dagegen triumphiert mit na? wahnsinnigen 48 Prozent.
Insgesamt dominieren Softails, Dynas und V-Rods, zusammengefasst unter
Custom Motorcycles, mit knapp 150000
Einheiten, dahinter folgen die Tourer mit 110000, die »kleinen« Sportster bringens auf runde 70000. Weil all diese V2-Chromstücke nicht eben billig kommen, tat ihr Hersteller gut daran, sich beizeiten vom rauen Jugendkult rund ums Bike zu verabschieden. Jeff Bleustein, einer der cleveren 13 und bis März 2005 oberster Steuermann bei Harley, befand 2003 im MOTORRAD-Interview sehr gelassen, das Motorrad stehe erst am Anfang seiner Erfolgsgeschichte. Es gehe lediglich darum, soziale Barrieren niederzureißen. Bleustein hat gut reden, seine Firma ist den anderen in
dieser Hinsicht meilenweit voraus, zählt
auffallend viele ältere, wohlhabende Herr-
sowie Damschaften zur Kundschaft, trifft
Manager wie Malocher mit ihren Public-Relations-Aktivitäten mitten in Herz und Portemonnaie.
Ein weiterer Trick, den die Firma sich freilich von der Biker- und Rockerszene abgeschaut hat: Jeder kann sich seinen V-Twin zum Unikat individualisieren. Ab Werk dank langer Extra-Listen oder beim Dealer, der mit Customizing-Artikeln ein erkleckliches Zubrot verdient. Die Company übrigens auch, sie setzt mit Motorradzubehör 850 Millionen Dollar um, allerdings in-
klusive Ersatzteilen. T-Shirt, Kaffeepott und Co. aber nicht mitgerechnet, die bringen noch mal 247 Millionen. Beide Posten
ergeben ergo ein Fünftel des Umsatzes die Konkurrenz erblasst vor Neid.
Erkennt jedoch neidlos an, dass hinter diesen Zahlen eine beeindruckende Geschäftigkeit steckt. Anders als die geruhsamen Endprodukte nämlich war das
Harley-Management in den letzten zwei Jahrzehnten verdammt flott. Noch Anfang der 90er Jahre reichten die Kapazitäten nicht mal für 80000 Motorräder. Dann
kamen in schneller Folge eine hoch-
moderne Lackiererei, ein Entwicklungszentrum und neue Produktionsanlagen hinzu. Heute müssen die insgesamt fünf Werke in den Bundesstaaten Wisconsin, Pennsylvania und Missouri weiteres Wachstum nicht fürchten. Eine kleine Montagestätte in Brasilien verleiht internationales Flair, immerhin zählen die Importeure in allen wichtigen Ländern ebenfalls zu den offiziellen Außenposten. Weshalb die Belegschaft weltweit stattliche 9600 Personen umfasst, davon bei rund 6500 in der eigentlichen Produktion knapp 8500 in den USA.
Wars das? Fast. Denn am Rande des Imperiums existiert ein Ableger, der ganz und gar andere Motorräder baut. Leicht, aggressiv, technisch verrückt. Buell. Schon 1993 hat sich die Company in das Un-
ternehmen ihres ehemaligen Ingenieurs Erik Buell eingekauft, fünf Jahre darauf
den Laden beinahe komplett übernommen, schlauerweise jedoch Buell als Chairman installiert. Bekanntlich werden all seine Motorräder von erheblich veränderten
Harley-Twins ge- und über Harley-Händler vertrieben. 11000-mal im Jahr 2005, zehn Prozent mehr als 2004. Eine doch sehr gedeihliche Verbindung und eine weitere Erfolgsgeschichte.
Historie 1903 bis 2006
Harley-Davidson wurde bekanntlich wer könnte den 100-Jahre-Trubel vergessen? im Jahr 1903 von den Brüdern Walter und Arthur Davidson sowie William Harley gegründet. Später kam noch William Davidson hinzu. Ihrer Manufaktur in Milwaukee entschlüpfen zunächst gewöhnliche, doch bald schon ziemlich zuverlässige 400er-Einzylinder mit Schnüffelventil als Einlasssteuerung, später anerkennend Silent Grey Fellow genannt. Die Weiten des Kontinents erfordern jedoch mehr Power, der erste V-Twin debütiert 1909, ebenfalls mit Schnüffelventilen und kaum zukunftsträchtig. Aber bereits mit 45 Grad Zylinderwinkel. 1911 machen sie es besser, der kompakte, wechselgesteuerte (Einlassventil hängend, Auslass stehend) F-Head entspricht dem Stand der Technik und besteht seine Musterung:
Die Armee, seit 1917 auf Seiten der
Alliierten im Ersten Weltkrieg, ordert 20000 Stück und wird Stammkunde.
Wahrscheinlich inspiriert von der viel bewunderten englischen Douglas, versucht sich Harley 1919 an einem Boxer. Der indes weil noch hitzeanfälliger als sein Vorbild und schwächer als die nationale Konkurrenz von Indian zum Glück fürs
V-Prinzip alsbald verschwindet. Trotzdem nennen sich die Amis so um 1920, als Europa unter den Kriegsfolgen ächzt, größte Motorradfabrik der Welt. Die Wirtschaftskrise ab Ende der 20er Jahre bringt allerdings auch Harley fast um, der Absatz sackt von 35000 Einheiten im Jahr 1926 auf 6000 in 1933. Erschwerend kommt hinzu, dass Fords Autos kaum mehr
kosten als die großen Harley-Tourer.
Mit dem seitengesteuerten Flathead-
Motor (beide Ventile stehen) gelingt auf
zivilem Terrain ein mittelfristiger Befreiungsschlag. Mehr Luft verschafft der endlich obengesteuerte Knucklehead-Motor. Dieser 1000er treibt ab 1936 die Dickschiffe an. Dann wieder ein Krieg 90000 Flatheads ziehen an die Front.
Die Legende will, dass Harley nur wegen dieses Auftrags genug Speck ansetzen konnte, um Indian zu überleben. Der einzig verbliebene nationale Konkurrent, vor dem Krieg meist erfolgreicher, macht 1953 dicht. Das großvolumige Motorrad ist zum Sportgerät geworden, den Markt dominieren Engländer. Milwaukee reagiert 1957, die für Harley-Verhältnisse schlanke Sportster mit 883 cm3 großem, Ironhead getauftem ohv-Motor debütiert und poliert das Image der altväterlichen Marke auf. Noch nachhaltiger soll sich auswirken, dass Tausende ehemaliger
Militärmaschinen einem Volkssport zum Opfer fallen, den seine Erfinder die
Rocker der Westküste choppen nennen. Alles weg, was nicht unbedingt zum Fahren nötig ist, die Twins starten ihre Out-law-Karriere. Und: Die Company verkauft ihr erstes Accessoire, eine schwarze Lederjacke. Mittlerweile bestellt Harley mehrere Verkaufsfelder. Die Big Twins werden auf Leichtmetall-Zylinderköpfe umgestellt,
deren Deckelform verleitet zum Spitznamen Panhead. Im Großtourer Hydra Glide wird erstmals eine hydraulisch gedämpfte Gabel verwendet. Als Kriegsbeute kamen einige DKW-Maschinen an den Michigan-See, eine Kopie der RT 125 beglückt nun auch die Amis, es folgen hubraumstärkere Varianten und sogar ein kleiner Scrambler. Weniger gefragt ist der Harley-Scooter, er überlebt sein Debütjahr 1960 nur knapp. Um europäische Konkurrenz abwehren zu können, wird 1960 die italienische Firma Aermacchi zugekauft. Allerdings können deren liegende Viertakt-Einzylinder gegen englische Sport-Twins wenig ausrichten. Ein Zweitakt-Single schlägt ebenfalls nicht sonderlich ein 1978 geht Aermacchi
im Cagiva-Gemischtwarenladen auf. Immerhin resultieren aus dieser Zeit vier Straßen-WM-Titel für Harley-Davidson,
die Walter Villa auf Zweitakt-Zweizylindern einfährt.
Alle anderen sportiven Erfolge sammelt Harley daheim. In den Anfängen bei Straßenrennen mit hochmodernen Ein- und Zweizylinder-Vierventilern, später und bis heute in typischen US-Disziplinen wie
Hillclimbing oder Dirt Track. Dort haben deftige Maschinen ihre Chance. Im Zivilleben ist Komfort angesagt: Die Japaner starten elektrisch, Harley schmunzelt zunächst und gibt 1965 klein bei. Ist von der Neuerung dann aber derart beglückt, dass der elektrifizierte Supertourer gleich E-Glide heißt. Bis heute.
Auf Pan- folgt 1966 Shovelhead, motorisches Aufbautraining reicht jedoch nicht mehr: Kurz vor dem Aus flüchtet Harley 1969 unter die Fittiche von AMF. Im Gefolge von Easy Rider und Flower Power bricht eine Cruiser-Welle los, Gründerenkel Willie G. Davidson bis heute Design-Chef in Milwaukee erkennt die Zeichen der Zeit und vereint in der Super Glide den Big Twin mit einem »schlanken« Fahrwerk. Das erste Custom Bike ist geboren.
1980 wird Harley zum technischen
Pionier und führt den Zahnriemen als Primär- und Sekundärantrieb ein. Das hält bis heute, genau wie die neue Firmenstruktur: 1981 kaufen 13 Manager die
Firma von AMF zurück. Sie stecken alle Entwicklungspower ins Evolution-Triebwerk, ein gemeinsam mit Porsche bereits angedachter wassergekühlter Motor wird storniert. Die Evolution Engine ist wie
neuer Wein in alten Schläuchen, endlich mit Leichtmetallzylindern, zum Beispiel, und echt haltbar. Der richtige Motor für eine 20 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte. Mitte der Neunziger knackt Milwaukee die 100000er-Marke, 2000 die 200000er, 2002 gehen über 250000 Bikes weg und 2004 schon 317000 eine auffallend starke Progression.
Die Evolution wird ständig evolutioniert, mit zwei Nockenwellen firmiert der Riese unter Twin Cam, den aktuellen Beinamen 88 verdankt er seinem Hubraum: 88 Kubikinches gleich 1449 Kubik- zentimeter. Wenn dann noch ein B folgt, zähmen zwei statt einer Ausgleichswelle die Vibrationen. Mit oder ohne B treibt der Twin Cam 88 heute alles an, was nicht Sportster heißt. Die vertrauen noch einem 1986 präsentierten Evolution-Derivat mit vier Nockenwellen. Aber auch Revolutionen hat Harley angezettelt. 2001 nämlich, als dann doch und wieder mit Unterstützung von Porsche ein wassergekühlter, ziemlich moderner und verdammt toller V2 eine neue Modellfamilie begründet. Die Rods, in Deutschland schon mit 15,6 Prozent an den Harley-Neuzulassungen beteiligt.
Interview mit Christian Arnezeder und Bernhard Gneithing
Christian Arnezeder (Geschäftsführer, links), 43, und Bernhard Gneithing (Marketing Director), 39, arbeiten bei der Harley-Davidson GmbH in Mörfelden. Von dort aus kümmern sich insgesamt 30 Mitarbeiter ums Harley-Ge- schäft in Deutschland und Österreich.
Die Company hat gerade ihr 20. Erfolgsjahr in Folge hingelegt. Da können Sie in Deutschland nicht mithalten, 2005 gabs ein Minus von rund 4,5 Prozent, 2004 war es noch größer. Kriegen Sie jetzt Druck aus Milwaukee?
Arnezeder: Harley-Davidson und Buell haben ihren Marktanteil seit 1999 in Deutschland um 15 Prozent gesteigert, bei Motorrädern über 650 cm³ sogar um 40 Prozent. Unser Marktanteil im Chopper- und Cruiser-Segment stieg um 230 Prozent. Das Mutterhaus ist sich sowohl der Situation auf dem deutschen Motorradmarkt als auch der Verbesserung, die wir hinsichtlich des Marktanteils erzielt haben, bewusst.
Harley-Davidson verkauft rund 80 Prozent seiner Produktion auf dem Heimatmarkt. In dieser Fixierung liegt doch auch ein gewisses Risiko, oder?
Arnezeder: Bei dieser Frage spielen gewachsene Strukturen eine große Rolle. Nach dem Bankrott von Indian 1953 blieb Harley-Davidson als einziger US-Motorradhersteller übrig. Wer als Amerikaner ein amerikanisches Motorrad fahren wollte, fuhr also fortan eine Harley. Trotz des erfreulichen Erfolgs in den USA ist Harley-Davidson aber keineswegs auf den US-Markt fixiert. Seit geraumer Zeit investiert die Motor Company intensiv in andere Weltmärkte. In Südafrika ist Harley-Davidson beispielsweise bereits erfolgreich unterwegs, in Moskau wurde soeben unsere erste Vertretung eröffnet, in China sind wir eine Partnerschaft mit einem heimischen Konzern eingegangen, um auf dem boomenden asiatischen Markt von Beginn an eine entscheidende Rolle spielen zu
können. Natürlich wird auch in Europa und
besonders in Deutschland weiter investiert. So haben wir 2004 in Bonn unsere europäische Service-Schule eröffnet.
Die Treffen in Faak oder Hamburg, im
Mai nun erstmals auch in Mainz, zeugen von einer enormen Markenbindung. Wodurch entsteht die?
Gneithing: Die entscheidende Rolle spielt hier die Markenperipherie, die Erlebniswelt namens Harley-Davidson. Willie G. Davidson hat das vor Jahren in den viel
zitierten Satz gefasst: »Die Kunden kaufen bei uns ein Lebensgefühl. Das Motorrad bekommen sie kostenlos dazu.« Freiheit, Individualität und Nonkonformismus prägen dieses Lebensgefühl und kennzeichnen die Einstellung der Harley-Besitzer, denn wie keine andere Marke repräsentiert Harley-Davidson diese Werte.
Wer heute eine Harley-Davidson erwirbt, der ist meist um die 40 und erfüllt sich einen lang gehegten Traum. Doch damit enden bereits die Gemeinsamkeiten in der Kundschaft. Alle Berufe und alle sozialen Schichten sind vertreten. Harley-Besitzer wissen, worauf es bei ihrem Bike ankommt. Man nimmt sich Zeit für den Genuss. Genuss am Fahren, Genuss an der Natur und Genuss an dem ästhetischen Objekt, auf dem man dahingleitet. Dies eint die »Harley-Gemeinde« die Harley Owners Group (H.O.G.) tut ein Übriges für die Familienbindung. Wer sich einmal für
eine Harley-Davidson entscheidet, wird auch künftig keine andere Marke wählen.
Wie groß ist denn die Markenbindung?
Gneithing: Harley-Kunden sind die markentreuesten unter den Motorradfahrern. 2005 waren 30 Prozent der Harley-David-son-Neukäufer »Wiederholungstäter«, zirka 60 Prozent fuhren zuvor ein anderes Fabrikat oder sind Wiedereinsteiger, und zirka zehn Prozent kaufen als erstes Motorrad eine
Harley-Davidson.
Wie verteilt sich bei uns der Verkauf der fünf Baureihen?
Arnezeder: Im Jahr 2005 verteilen sich die Neuzulassungen wie folgt: Sportster: 25,9, Dyna: 10,6, Softail: 31,7, Electra Glide: 16,2 und VRSC: 15,6 Prozent. Einige weitere Neuzulassungen wurden nicht erfasst.
Und Ihre erfolgreichsten Modelle?
Arnezeder: Hier unsere 2005er-Hit-
liste: 1. Sportster 1200 Custom, 2. Road King, 3. Fat Boy, 4. Dyna Super Glide Custom, 5. Softail Deluxe. Allerdings kämen die sehr ähnlichen V-Rod VRSCA und VRSCB zusammen genommen auf den ersten Platz.
Mit der V-Rod, noch mehr aber mit der Street Rod haben Sie Ihren Kundenkreis ausgeweitet. Was dürfen wir von dieser Baureihe noch erwarten? Hat Erik Buell schon angefragt, ob er den Revolution-Motor mal verwenden darf?
Gneithing: Unser Unternehmen äußert sich grundsätzlich nicht zu zukünftigen Projekten. Aber die Bedeutung der VRSC-Baureihe ist für Harley-Davidson groß. Natürlich werden wir darüber keinesfalls die ruhmreichen, luftgekühlten V-Twins vergessen. Mit ihnen ist Harley-Davidson groß geworden.
Brembo liefert Bremsen für Harley. Brembo hat auch ein ABS. Wann wird das endlich ein
Thema in der Company?
Arnezeder: Da sich Harley-Davidson nicht zu künftigen Projekten äußert, können wir zum Thema ABS nicht Stellung beziehen.
Nachdem einige Harley-Manager ein millionenschweres Aktienpaket verkauft hatten und kurz darauf die Verkaufsprognose für 2005 gesenkt wurde, gab es eine sehr spektakuläre Anklage von Aktionären. Nun war das 2005er-Ergebnis prächtig; ist diese Klage damit erledigt?
Arnezeder: Zu diesem Thema können wir leider nicht Stellung nehmen.