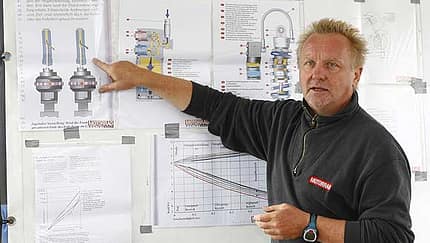Das Fahrwerk, ja, das Fahrwerk«, leitet der Werner seine Rede ein, »ist schon eine komplexe Sache.« Klar sei bestenfalls: Alles hängt irgendwie mit allem zusammen, und jede Änderung an einer Stelle bringt neue Probleme an einer an-deren. Das ist vermutlich genau, was die Teilnehmer an diesem Workshop so weit selbst erfahren haben. »Aber«, fährt der Werner fort, »im Normalfall bekommt man ein Fahrwerk immer so hin, wie es sein sollte.« Zwar gebe es keine optimale Einstellung schlechthin. Doch einen optimalen Kompromiss, den gebe es für jeden.
Das war ein guter Satz, ein beruhigender, etwas in der Art haben sie hören wollen, die Männer, die mit ihren Maschinen zum Testgelände nach Boxberg im Main-Tauber-Kreis gekommen sind. Da sitzen sie nun unter einem Zeltdach und hören Werner zu. Der wiederum ist wie gemacht für dieses Seminar. Hat einige Fahrwerke selbst konstruiert und über das Thema
ein Buch verfasst, zusammen mit Benny Wilbers. Noch dazu kann der Werner das, was er so alles weiß, in Vorträge und Anekdötchen packen, die ebenso informativ wie amüsant rüberkommen.
Als er fragt, ob denn jeder wisse, wie er sein Fahrwerk momentan eingestellt habe, kommt von den Gefragten keine eindeutige Reaktion. Offenbar wissen sie es nicht. Aber rauskriegen müssen sie es. Nur wie? Indem sie sich ihrem Gerät, mit Formblatt, Kugelschreiber, Schraubenzieher und Zollstock gerüstet, nähern. Um Sachen wie Negativfederweg, Druckstufe und Zugstufe zu eruieren.
Von all dem hat Michael noch keinen Schimmer. Zwar fährt er schon seit 40 Jahren Motorrad, doch am Set-up seiner
Maschinen hat er bislang nie was verändert, hat sie immer so gefahren, wie sie vom Händler kamen. »Am Ende stellt man rum, und dann gerät man in eine kritische
Situation und versaubeutelt alles, weil
das Motorrad so katastrophal eingestellt ist.« So hat er denn bei Werners Vortrag – kurzweilige 2,5 Stunden zwischen Federn und Dämpfern, Druck und Zug, Komfort und Stabilität – »mehr gelernt als in
40 Jahren zuvor«. Und die Vorbehalte,
sich mit dem Fahrwerk zu beschäftigen,
weichen einer zurückhaltenden Neugier. Die ihm, ein paar Verrichtungen mit dem Schraubendreher später, offenbart, dass die Gabel seiner gerade mal 1500 Kilo-
meter gelaufenen Kawasaki ZZR 1400 links mit vier Klicks Zugstufe werkelt. Und rechts mit deren sieben. Er habe das, meint Michael, gar nicht gemerkt, gesteht jedoch ergänzend, dass er mit einer
Fahrleistung von nicht mehr als 2000
oder 3000 Kilometern im Jahr nicht so
ein »Feinschmecker« sei, dass er alles so
genau beurteilen könnte.
Zumindest aber hat er mal probiert. Und weiß jetzt zu goutieren, dass er
wenigstens theoretisch kapiert, warum es
ihm im Falle seiner Maschine keine Kopfschmerzen bereiten muss, dass er mit leicht unterschiedlichen Klicks links und rechts unterwegs ist. Praktisch nämlich wirkt sich das nicht gravierend aus. Weil,
so erklärt Werner, diese Gabel zwar
jede Menge Klicks aufweise, diese jedoch
nur in einem eher kleinen Bereich tatsächlich Wirkung zeigen würden. Die ZZR 1400 ist da kein Einzelfall.
Ähnlich sieht die Sache bei der Triumph Daytona 675 aus, mit der Volker zum Workshop kam. Deren Federbein tut hervorragende Dienste, ohne Frage. Indes
lediglich bei fast komplett geschlossener Zugstufe. Allein die ersten zwei oder drei Klicks von zu nach auf respektive »+« nach »-«, beeinflussen das Fahrverhalten entscheidend. Im übrigen »Einstellbereich« bleibt das Fahrverhalten gleich unbefrie-
digend – federt das Heck zu schnell aus. Volker, der seine 675 ausschließlich auf der Rennstrecke bewegt, bekundet: »Das hat mir mein Händler so eingestellt, der hat gesagt, das passt so gut für meinen Einsatzzweck.« Werner sagt: »So kannst du die auf der Rennstrecke aber nicht fahren.« Dann drückt er auf den Bürzel, das Heck geht in die Knie, und als Werner loslässt sieht man, dass es zu schnell hochkommt.
Verdammt lang hat er sich beim
Top-Test auseinandergesetzt mit der Abstimmung der Triumph, der Werner. Ob er denn die Einstellung noch wüsste, fragt Volker ihn, und als Werner sagt, ja, ja, das
bekomme er noch zusammen, setzt Volker nach, ob er ihm später die Einstellung denn machen könne? »Klar, jeder bekommt heute seine richtige Einstellung verpasst.« Das freut Volker: »Toll, dafür bin ich ja hierher gekommen.«
Umso toller, für Volker so wie für die anderen, dass sie nicht nur unter Anleitung an ihrer Einstellung arbeiten dürfen. Wenn sie Werners Ausführungen und Demonstrationen am toten Objekt – zerlegte Gabeln, offene Federbeine – brav folgen, nehmen sie auch das lebendige Wissen mit nach Hause, warum diese oder jene Einstellung für sie die beste darstellt. Denn der Werner erklärt zusammen mit seinem Test-Kollegen Georg Jelicic nicht nur, wann mehr Zug-, Druckstufe oder Federvorspannung vonnöten sind. Die beiden erklären und zeigen zudem, was in Federbein und
Gabel passiert, wenn etwa die Druckstufe
erhöht wird: Eine konische Nadel wird
weiter in ein Ventil gedreht, der Ringspalt
zwischen Nadel und Bohrung verengt sich. Und je kleiner der Spalt, desto weniger gern lässt das Öl, mit dessen Hilfe die Dämpfung eben arbeitet, sich hindurchquetschen.
Die Größe des Spalts könnte Robin weiterhelfen. Er nämlich klagt über zu
wenig Steifigkeit, nicht vorne, aber hinten, da mangele es seiner Suzuki GSX-R 1000 doch arg an Stabilität und Feedback.
Was Werner nach kurzem Check überhaupt nicht wundert. Das Federbein kann seiner Ansicht nach sowohl mehr Zug-
als auch mehr Druckstufe vertragen. »Stabilität kommt immer über die Hydraulik,
weniger über die Feder. Mehr Dämpfung bringt mehr Steifigkeit, und das bringt dann auch mehr Gefühl für das, was
das Rad macht.« Nach ein paar Runden über den mit Pylonen abgesteckten Testparcours grinst Robin: »Das Ding ist jetzt
ja richtig gut.« Und in dieser Äußerung schwingt mit, wie es vorher war.
Ganz so weit sind die anderen noch nicht. Stefan zum Beispiel hat sich unter seiner RSV mille vergraben, kneift die
Augen zusammen und sucht und sucht und sucht. Wo sind am Sachs-Federbein
die richtigen Schräubchen? Denn auf der Holperstrecke des Boxberger Testgeländes hopst und springt die Aprilia wie ein
Känguruh. »Normalerweise bezeichnen wir so was als Luftpumpe«, urteilt MOTORRAD-Tester Georg. Er hat sich zu Stefan gesellt und empfiehlt als erste Maßnahme mehr Druckstufe. Der Dämpfer setzt dem Druck aufs Heck nämlich so gut wie keinen Widerstand entgegen.
Er hat, sagt Stefan, gezählt, dass 20 von 41 Klicks zu waren. Probehalber dreht er mal völlig zu. Und spürt keinen Unterschied. Vielleicht zeigt ja die Verstellung der Zugstufe mehr Wirkung? Deren Verstellschraube erspäht Stefan schließlich durch einen kleinen Spalt in der Verkleidung. Also mehr Klicks zu. Und, oh Wunder, mit stark erhöhter Zugstufe setzt das Federbein auch dem Druck mehr Widerstand entgegen. »Ist normal«, sagt Georg, »bei so einem Großseriendämpfer kommt es öfter mal vor, dass sich auch die Druckstufe verändert, wenn man die Zugstufe justiert«.
Noch ganz andere Sachen kommen vor: »Wir hatten hier beim Workshop schon mal einen«, sagt Werner, »der hatte bereits die ausgefüllte Bestellung für Öhlins dabei. Der wusste sich keinen Rat mehr sonst. Was der aber brauchte, war nichts anderes als vorne und hinten 0,5 bar mehr Luft
in den Reifen. Damit fuhr das Motorrad, wie es sollte.“
Vor der richtigen Einstellung - Vor der richtigen Einstellung
Einiges ist zu checken. Wer versuchen will, sein Set-up zu finden, sollte
nicht gleich wild drauflos klicken und drehen, sondern erst mal prüfen, ob mit seinem Ofen alles in Ordnung ist.
Stimmt der Luftdruck? Korrekte
Angabe steht im Handbuch. Manchmal sprechen die Reifenhersteller andere Empfehlungen aus. Dann ausprobieren, was besser passt.
Laufen alle Teile sauber und leicht? Eine zu fest angezogene untere
Gabelbrücke kann zum Beispiel das Tauchrohr im Standrohr einklemmen. 20 Newtonmeter Anzugskraft reichen in der Regel. Außerdem sollten die
Gabelholme parallel und eben nicht verspannt montiert sein.
Ist das Lenkkopflager korrekt angezogen? Der Lenker muss sich bei entlastetem Vorderrad ohne Kraft hin und her bewegen lassen, darf nicht rasten. Beim Vorschieben und abrupten Bremsen sollte sich mit dem an die Lagerschale gelegten Finger dort kein Spiel feststellen lassen.
Stimmt die Spur? Zwei gerade Latten mittels Gummiband rechts und links des Hinterreifens fixieren und parallel ausrichten. Die beiden Abstände links und rechts des Vorderrads müssten dann identisch sein.
Spiel im Schwingenlager? Axiales Spiel (hin und her entlang der Achse) ist nicht so schlimm, radiales (vertikale und horizontale Bewegung um Mittelpunkt) unter Umständen schon. Bei entlastetem Hinterrad an der Schwinge ruckeln. Auch die Radlager sollten entsprechend überprüft werden.
Fahrwerks-Workshop von Werner Koch - Glossar
Federung: Die Federn verbinden die ungefederten Massen (Räder...) mit den gefederten (Tank,
Rahmen...). Die Federrate oder -härte gibt an, wie viel Kraft nötig ist, um die Feder einen Zentimeter
zu komprimieren. Das hängt ab von der Dicke des Stahls, dem Durchmesser und der Anzahl der Wicklungen. Lineare Federn sind gleichmäßig gewickelt, ihre Rate bleibt über den gesamten Weg gleich. Progressive verfügen über unterschiedlich enge Wicklungen, sind im ersten Bereich weicher, im weiteren nach dem Kontakt einzelner Wicklungen härter.
Federbasis: wird oft auch als »Vorspannung« bezeichnet. Verstellt man die Federbasis über Rändelmuttern, wird der Negativfederweg beeinflusst.
Mehr Vorspannung reduziert den Negativfederweg. Das ist, grob gesagt, der Ausfederweg, wohinge-
gen sich der Positivfederweg als Einfederweg verstehen lässt.
Dämpfung: ist eine ölige Sache. Öl in der Gabel und dem Federbein wird von einer in eine andere Kammer gedrängt, und zwar durch ein Nadelventil und dünne Federstahlplättchen, die so genannten Shims. Das lässt sich das Öl nicht widerstandslos gefallen. Es setzt der Bewegung, die es in Bedrängnis bringt, eine Kraft entgegen. Das Öl dämpft so die Bewegung der Feder. Sowohl beim Einfedern (Druckstufe) als auch beim Ausfedern (Zugstufe).
Druckstufe: Sie unterstützt die Federkraft und wirkt sich auf die Einfedergeschwindigkeit aus, darauf, wie schnell es die Feder auf einen Schlag zusammenstaucht. Mehr Druckstufe bringt mehr Härte, mehr Feedback, weniger Komfort.
Zugstufe: Sie wirkt der Federkraft entgegen, verhindert also, dass die Feder sich nach einer Kompression ungehindert und damit zu schnell wieder auf volle Länge dehnt. Denn das Ausfedern soll kontrolliert und sämig vonstatten gehen, damit das Motorrad nach Bodenwellen nicht ins Pumpen kommt und nachschwingt.
Klicks: Sie bestimmen die Dämpfung. Um herauszufinden, wie die Dämpfung eingestellt ist, dreht man mit Werkzeug oder per Hand den entsprechenden Knopf vorsichtig bis auf Anschlag nach links und merkt sich die Zahl der Klicks. Hernach anders
herum, wieder bis zum Anschlag. So findet man zum Beispiel heraus, dass man die Zugstufe 14 von 40 Klicks zu hatte. Die Gesamtzahl der Klicks entspricht allzu oft leider nicht dem effektiven Einstellbereich, also dem Bereich, in dem das Auf und Zu tatsächlich Wirkung zeigt. Diesem nutzbaren Bereich muss man sich Klick für Klick nähern. Einmal drehen, probieren und so weiter.
Öl: steckt in der Gabel, steckt im Dämpfer, dick
oder dünn. Je dickflüssiger, je höher die Viskosität,
desto härter reagieren Druck- und Zugstufe. Mehr
Öl bedeutet in der Gabel weniger Luftpolster und eine höhere Durchschlagreserve. Unter Umständen aber reagiert die Gabel dann bockiger.
Balance: hat weniger was damit zu tun, ob die
Maschine umfällt oder nicht, sondern damit, dass die Abstimmung von Gabel und Federbein zusammenpassen muss. Front und Heck haben in der Grundhärte zu harmonieren, auf dass die Maschine nicht vorne, weil sehr hart, herumzappelt, während sie hinten einknickt wie ein hüftkranker Schäferhund.