Der Plan klingt verlockend: mit neuen Motorrädern eine alte Marke wiederzubeleben. Der Name ist den Fans dann bereits geläufig, das mühsame Bekanntmachen eines Newcomers entfällt. Viele dieser Versuche scheitern jedoch; sich in Zeiten strenger Homologationsvorschriften auf dem internationalen Markt durchzusetzen, ist kein Kinderspiel. Neben einem guten Namen braucht es eine geschickte Strategie, begeisternde Modelle und vor allem viel Geld.
Dennoch kommt es immer wieder zur vollmundigen Ankündigung eines Comebacks. 2015 standen auf der Herbstmesse in Mailand eine 125er und eine 250er, offenbar aus südostasiatischer Fertigung, mit dem großen Namen Mondial. Im Jahr zuvor präsentierte sich in Mailand ein sündteures Einzelstück namens Matchless, das danach in der Versenkung verschwand. Mehr Anlass zur Hoffnung gibt die wiederbelebte italienische Offroad-Marke SWM. Sie hat bereits Produktion und Vertrieb mehrerer Modelle aufgenommen; ob sie eine echte Zukunft hat, dürfte von der Geduld des chinesischen Geldgebers abhängen.
Erfolgsstorys sind selten. Einzig Triumph hat es bislang geschafft, einem alten Namen wieder echtes Leben und neuen Glanz zu verleihen. Auch Indian dürfte gute Chancen haben, doch viele Beispiele auf den folgenden Seiten ähneln eher einer Chronologie des Scheiterns. Nicht einmal MV Agusta, der wohl legendärste Name aller Zeiten, scheint dagegen gefeit: Zwar ließen es die Macher beim Neustart keineswegs an Enthusiasmus und Sachverstand fehlen, doch mangels ausreichenden Kapitals schwebt die Marke bis heute am Rand des finanziellen Ruins.
Indian

Das sieht vielversprechend aus: Die jüngst erfolgte Wiederbelebung der US-Marke Indian durch den Quad- und Snowmobil-Hersteller Polaris hat das Zeug zur Erfolgsgeschichte. Denn Neueigner Polaris verfolgt offensichtlich einen präzisen Plan und verfügt über das nötige Kleingeld, um die schwierigen Anfangsjahre zu überstehen. Zudem hat sich Polaris einen wirklich großen und alten Namen ausgesucht. Gegründet wurde Indian im Jahr 1901 in Springfield/Massachusetts. Das erste verkaufte Motorrad, ein Einzylinder-Modell, war kaum mehr als ein Fahrrad mit Hilfsmotor, triumphierte aber gleich bei seinem Renndebüt, dem Langstreckenrennen von Boston nach New York im Jahr 1902. Schon in den 20er-Jahren waren Indians überaus populär, in vielen US-Metropolen gehörten sie mit ihrer niedrigen Sitzposition, der Blattfedergabel am Vorderrad und den tief herunter gezogenen Kotflügeln zum Straßenbild. Während des ersten Weltkrieges avancierte die Marke, auch dank ihrer Militärproduktion, zum größten Motorradhersteller der Welt. Viel zur Beliebtheit trugen Innovationen wie die Seitenventilsteuerung bei, mit der kaum ein anderer US-Hersteller glänzen konnte. 1933 stieg Indian von Verlustschmierung und Tropföler auf eine Trockensumpfschmierung um – was den Motorrädern eine Langstreckentauglichkeit verlieh, von der Harley-Kunden nur träumen konnten.
Dennoch verlor Indian den Konkurrenzkampf der beiden großen US-Hersteller. Nicht zuletzt, weil die Indians immer schwerer wurden, die Ingenieure ihnen aber nur unwesentlich mehr Leistung spendierten. 1945 erwarb eine Investment-Gruppe die Firma, wollte mit kleineren und leichteren Modellen einen neuen Kundenkreis erschließen. Die Rettung misslang, 1953 ging Indian in Konkurs. Es folgten mehrere Wiederbelebungsversuche, unter anderem wollte Ende der 60er-Jahre der deutsche Entwickler Friedel Münch Indian mit einer „Münch-Scout“ neues Leben einhauchen.
Doch erst Polaris scheint nun Erfolg beschieden. Die US-Firma mit Sitz in Minnesota gründete 1997 die Motorradmarke Victory, kaufte 2011 die Namensrechte an Indian und macht sich nun daran, Harley herauszufordern – nicht auf deren Rustikalschiene, sondern mit moderner Technik. So ließ man sowohl den 1,8-Liter-V2 der Chief als auch den 1,1-Liter-V2 der Scout von der Schweizer Firma Swissauto entwickeln, die schon in der Motorrad-WM zu Siegen fuhr und deren Powersports-Sparte mittlerweile zum Polaris-Konzern gehört. Bei aller Hightech verliert Indian die Tradition nicht aus dem Auge: Der 1,8-Liter-Motor imitiert optisch die Seitenventilsteuerung von einst.
Die Verkaufszahlen liegen zwar noch weit hinter denen von Harley, doch sie steigen stetig. Bleibt die Frage, ob Indian es schafft, genügend Harley-Puristen zum Umsteigen zu bewegen. Ein Comeback nach über 60 Jahren – das hat Stil und hätte ein Happy End verdient.
Triumph

Triumph – das ist die Geschichte einer einst großen englischen Marke, die am Boden lag, pleite, die Werkshallen niedergerissen. Und es ist die Geschichte eines Mannes, der die Trümmer zusammenklaubte, die Marke mit dem richtigen Geschäftsmodell zu alter Größe führte und dafür den Order of the British Empire erhielt. Eine Geschichte, fast zu schön, um wahr zu sein.
In den 70er-Jahren siecht Triumph nur noch vor sich hin. Die japanischen Hersteller mit ihren Vierzylinder-Superbikes haben der Marke arg zugesetzt, auch der Zusammenschluss mit anderen britischen Herstellern zum Konglomerat „Norton-Villiers-Triumph“ kann den Niedergang nicht aufhalten. Als das Werk in Meriden westlich von Birmingham 1973 geschlossen werden soll, besetzen die Arbeiter die Hallen und erreichen, dass sie den Bau der Motorräder als Genossenschaft fortsetzen dürfen. Doch 1983 ist das Projekt pleite und Triumph tot.
Nun tritt John Bloor auf den Plan. Ein Mann aus der Bau- und Immobilienbranche. Von Motorrädern hat er kaum Ahnung. Dafür hat er Geld. Und eine Vision. Er baut in Hinckley, nur 20 Meilen von Meriden entfernt, eine neue Fabrik und lässt in aller Ruhe eine neue Produktlinie entwickeln. Sieben Jahre später, 1990, präsentiert er auf der IFMA in Köln die ersten Modelle. Bloor setzt zunächst auf Drei- und Vierzylindermaschinen, um dann schnell zu merken: Inline-Four kann Japan besser. Fortan lässt Bloor nur noch Triples und den klassischen Paralleltwin bauen.
Das Konzept geht auf, die Verkaufszahlen entwickeln sich positiv. Als Tom Cruise im Jahr 2000 in „Mission Impossible II“ mit einer Triumph Speed Triple über die Leinwände brettert, steigt der Absatz im Jahr darauf auf 31000 Motorräder. Triumph schreibt wieder schwarze Zahlen, erstmals seit Jahrzehnten. Bloor hat bis dahin über 100 Millionen Pfund investiert. Selbst ein Großfeuer, das 2002 das Werk in Hinckley zerstört, kann ihn nicht aufhalten. Schon Monate später steht eine neue Fabrik.
Heute liegen die Verkaufszahlen bei über 50000 Stück, Triumph produziert außer in England auch in Thailand und Brasilien. Und John Bloor, der mit seiner Hausbaugesellschaft „Bloor Homes“ und mit Triumph gleich zwei Unternehmen zum Erfolg geführt hat, wird in der „Rich List“ der Sunday Times als Milliardär geführt. Dabei pflegt der heute 73-Jährige einen bescheidenen Lebensstil, Interviews gibt er ungern. Die Triumph-Geschäfte hat er weitgehend an seinen Sohn Nick übertragen, der seit 2010 als Geschäftsführer firmiert.
Triumph ist heute wieder das, was es mal war: Englands Nummer eins im Motorradbau.
Royal Enfield

Bullet. Ein Name, ein Mythos. Kein Motorrad weist eine längere Historie auf als die Bullet, die 1933 auf den Markt kam und noch heute gebaut wird. Allerdings längst nicht mehr in good old Britain wie zu Beginn, sondern in Indien – eine Geschichte, die beweist, dass man auch mal der Kolonialmacht ein Schnippchen schlagen kann. Im Gegensatz zu den anderen Marken stellte Royal Enfield die Produktion nie wirklich ein, sondern wechselte nur das Land und zwischendurch auch mal den Namen. Doch der Reihe nach: Gegründet wurde die Firma bereits 1893, sie baute zunächst Teile für Waffen und Fahrräder. Das erste Motorrad ging 1901 in Produktion. Weil der robuste Einzylinder Bullet 350 in Indien gut ankam, lagerte Royal Enfield 1956 einen Teil der Produktion nach Madras, dem heutigen Chennai, aus.
Konfrontiert mit immer weiter steigenden Kosten, musste die Mutterfirma im englischen Redditch 1970 schließen, während die Inder unabhängig weiterproduzierten. Zunächst unter dem Namen „Enfield of India“. Erst 1994, als der indische Industriekonzern Eicher Group die Firma übernahm, wurde sie wieder in Royal Enfield umbenannt. Heute verkauft der Hersteller in Indien über 400.000 Motorräder im Jahr, in den Export gehen aber nicht mal 10000 Stück. Es kommen ausschließlich luftgekühlte Einzylinder-Viertakter zum Einsatz, und zwar in den drei Retro-Modellen Classic, Bullet und Continental GT sowie dem Cruiser Thunderbird und der Enduro Himalayan. Mutterkonzern Eicher hat offenbar große Pläne mit Royal Enfield: Der Export soll ausgebaut werden, in Chennai entsteht eine neue Fabrik, nahe Birmingham ein neues Entwicklungszentrum und es gibt erste Fotos einer neuen 750er mit Paralleltwin.
Norton

Eine solche Chance bekommst du nur einmal in fünf Leben.“ Das sagt der britische Selfmade-Millionär Stuart Garner, der 2008 die Namensrechte an Norton kaufte und der Marke neues Leben einhauchte. Der 46-jährige Garner, der sein Vermögen unter anderem mit Feuerwerkskörpern und der Zucht seltener Antilopen für Safari-Parks machte, erwarb später auch noch Schloss Donington nahe der gleichnamigen Rennstrecke, wo Norton heute residiert. Das passt, denn zum einen lag der Stammsitz einst im nahen Birmingham, zum anderen ist die Marke untrennbar mit dem Rennsport verbunden. 1898 von James Norton gegründet, stand bereits bei der ersten Tourist Trophy auf der Isle of Man im Jahr 1907 eine Norton ganz oben auf dem Treppchen; zahllose weitere TT-Titel folgten. Bis Mitte der 50er-Jahre dominierten die Motorräder den internationalen Motorradrennsport. Vor allem die gefeierte Manx, gebaut von 1949 bis 1962, war ein Sieg-Garant; ihr Einzylinder wurde sogar zum gängigen Antrieb der Cooper-Formel-3-Rennwagen.
Trotz oder vielleicht wegen der Rennerfolge ließ sich der Niedergang nicht aufhalten. In den 50er-Jahren wurde Norton gemeinsam mit anderen darbenden Marken wie AJS und Matchless im AMC-Konzern (Associated Motor Cycles) zusammengefasst, der jedoch bald pleiteging. Aus der Asche entstand der Hersteller Norton-Villiers (später kam noch Triumph dazu), der in den 70ern mit der Norton Commando einen kurzen Aufschwung erlebte. Auf Dauer jedoch konnte die rückständige Technik nicht gegen die modernen japanischen Modelle bestehen. In den 80ern wurden die Rechte an Norton weltweit gesplittet, mehrere Wiederbelebungsversuche scheiterten kläglich. Bis der bekennende Motorradnarr Stuart Garner kam und mit ihm das nötige Kapital. Er lässt heute Kleinserien der Modelle Dominator und Commando in Handarbeit fertigen – mit ordentlichem Erfolg.
Münch
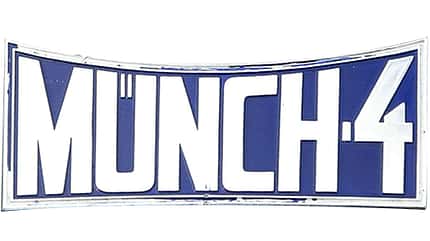
Friedel Münch war ein Technik-Enthusiast, der die Extreme liebte: viel Hubraum, viel Leistung, lautete sein Credo. Seine unternehmerischen Fähigkeiten waren eher mäßig, weshalb er bei seinen Projekten wiederholt in Finanznöte geriet. Der Techniker und Tüftler arbeitete erst in der Horex-Rennabteilung und handelte später mit Motorrädern, ehe er Mitte der 60er-Jahre ein eigenes Motorrad konzipierte. Er nahm einen Vierzylinder-Automotor aus dem NSU Prinz 1000, entwarf einen Rahmen, schraubte die Doppelscheinwerfer des NSU dran – fertig war die erste Mammut. Münch, dem sie nachsagten, er könne noch aus einer Blechdose ein Motorrad bauen, fand immer wieder Partner, die seine Leidenschaft zumindest zeitweise finanzierten. Etwa den US-Verleger Floyd Clymer. Oder den Millionärssohn George Bell. Anfang der 70er-Jahre rettete ihn der Verpackungsmittelhersteller Hassia, und kurz darauf entwarf Münch die Mammut TTS-E, das erste Serienmotorrad der Welt mit mechanischer Benzineinspritzung. Als sich Hassia zurückzog, musste er Konkurs anmelden. Eine Kooperation mit dem Unternehmer Heinz W. Henke, der die Konkursmasse und die Namensrechte gekauft hatte, ging 1977 in die Brüche. Daraufhin entwickelte Münch auf eigene Faust weiter. Er trieb den Hubraum der Mammut nach oben, bis hin zum Modell „Titan 2000“ mit 2000 Kubik, 154 PS und Wankel-Halbwalzen-Kompressor.
1997 wollte der Geschäftsmann Thomas Petsch den Mythos Münch neu beleben. Doch seine Mammut 2000 (2000 cm3, Turbo, 265 PS) balancierte am Rande der Unfahrbarkeit: das Turboloch groß, das Handling kläglich. Nur acht Mammut 2000 (Preis: Rund 170.000 Mark oder 86.000 Euro) wurden verkauft. Heute liegen die Namensrechte bei der Firma DBH in Lüneburg, die Münchs restauriert und Replicas der Münch TTS-1200 und TTS-E 1200 fertigt – wegen der Abgas- und Geräuschvorschriften aber ohne Straßenzulassung.
Horex

Juli 2012. Die deutsche Traditionsmarke Horex soll neu aufleben. Clemens Neese heißt der Mann, der die Horex-Namensrechte erworben hat. Nun hat er die Presse zur Testfahrt mit seiner neuen Horex VR6 Roadster geladen. Doch die Journalisten kämpfen mit festgehenden Bremsen und austretendem Kühlwasser – die VR6 erweist sich als nicht vorzeigbares, gar gefährliches Vehikel. Zwar überstehen alle die Testfahrt unversehrt, doch Neese und Horex sind zwei Jahre später insolvent.
Das Horex-Debakel ist ein Musterbeispiel für ein missglücktes Marken-Revial: zu wenig Kapital, zu wenig Manpower, zu wenig Ressourcen, um ein Motorrad zu entwickeln. Ein großer Name und Enthusiasmus allein genügen nicht.
Es war Fritz Kleemann, der die Firma Horex 1923 im hessischen Bad Homburg gründete. Die ersten beiden Buchstaben der Stadt sowie das Warenzeichen der elterlichen Rex-Konservenglasgesellschaft ergaben den Firmennamen. In den 30er-Jahren überzeugten die Horex-Ingenieure mit fortschrittlichen Ideen. Da war der Paralleltwin mit jeweils dreifach gelagerter Nocken- und Kurbelwelle von 1932. Oder der 350-cm3-Viertaktmotor, Typenbezeichnung SB35, der seiner Zeit voraus war.
Nach dem Krieg löste das Modell Regina die SB35 ab und wurde mit ihrem 350-cm3-Einzylinder zum erfolgreichsten Motorrad der Firmengeschichte. 1952 war sie gar die meistverkaufte 350er weltweit.
Doch dann sanken die Verkaufszahlen rapide, 1956 stellte Horex die Produktion ein. Die Namensrechte erwarb zunächst Friedel Münch, dann der Importeur Fritz Röth, der in den 80er-Jahren billige Mokicks und Mofas unter dem Namen Horex bauen ließ. Nach dem misslungenen Intermezzo von Clemens Neese übernahm 2015 die Firma 3C-Carbon Group im bayerischen Landsberg am Lech die Firma Horex. 3C agiert ambitioniert: Die VR6 (Sechszylinder-V-Motor, 1218 cm3, über 160 PS) wurde grundlegend überarbeitet, bis Ende 2016 sollen 150 Motorräder gebaut werden. Auf dem ursprünglichen Fabrikgelände in Bad Homburg ist Ende August die Eröffnung eines Flagship-Stores geplant.
MV Agusta

Claudio Castiglioni lachte nur wissend, wenn er in späteren Jahren auf die Gerüchte um die Wiedergeburt von MV Agusta angesprochen wurde: Es hieß, er habe die Namensrechte bei einer Pokerpartie mit Rocky Agusta gewonnen, Erbe der gleichnamigen Firma und schillernde Figur des italienischen Jetsets. Ob das nun stimmt oder nicht: Fakt ist, dass Castiglioni, damals Boss der Marken Cagiva und Ducati, Anfang der 90er-Jahre in den Besitz der Namensrechte kam. Der charismatische Unternehmer machte sich zusammen mit seinem Freund, dem genialen Entwickler Massimo Tamburini, ans Werk und präsentierte der Motorradwelt 1997 den atemberaubend schönen Vierzylinder F4, erstes Modell der wieder erstandenen Marke MV Agusta. Kurz zuvor hatte Castiglioni die Firma Ducati aus finanziellen Gründen an einen US-Fonds abgeben müssen und konzentrierte sich nun voll auf MV Agusta, den wohl größten alten Namen der Motorradbranche.
Um MV rankten sich bereits im ersten Leben der Marke, das 1977 endete, zahlreiche Mythen. Was unter anderem daran lag, dass ihr damaliger Besitzer, der Graf Domenico Agusta, in seinem Firmenreich absolutistisch herrschte und kaum Informationen nach außen drangen. Vor allem aber gründet der Mythos auf den ungeheuren Rennerfolgen. 37 Konstrukteurs- und 38 Fahrertitel holte MV zwischen 1954 und 1974, viele davon mit dem Rennfahrer Giacomo Agostini, der wie die Marke zur Legende wurde.
Gegründet wurde Meccanica Verghera Agusta, so der volle Name,1945 in Samarate bei Mailand als Ableger des Flugzeugherstellers Agusta. Schon die erste Maschine, den Zweitakter 98, schickte Firmenchef Domenico Agusta auf die Rennstrecke. Zwar produzierte MV im Lauf der Jahre zahlreiche Straßenmodelle, doch das eigentliche Interesse des Grafen galt einzig dem Rennsport, den er vor allem über die Flugzeugfabrik finanzierte. Nach seinem Tod 1971 versiegten die Geldzuwendungen des Mutterkonzerns allmählich, 1977 stellte MV den Betrieb ein.
Das Comeback 20 Jahre später wurde mit viel Enthusiasmus vorangetrieben, doch bald kam es zu finanziellen Krisen. 2004 verkaufte Claudio Castiglioni die Mehrheit von MV Agusta an den malaysischen Autobauer Proton, erhielt sie aber ein Jahr später zum symbolischen Preis von einem Euro zurück. Im August 2008 dann kaufte Harley-Davidson die Marke, nur um sie zwei Jahre später an Castiglioni zurückzugeben, wiederum für einen Euro. Heute hält Mercedes-AMG 25 Prozent an der Firma; dennoch musste Giovanni Castiglioni, seit dem Tod seines Vaters 2011 MV-Chef, im April 2016 wegen finanzieller Engpässe Gläubigerschutz beantragen und muss demnächst einen Sanierungsplan vorlegen, über den im Herbst entschieden wird. Wie es mit MV Agusta weitergeht, steht derzeit nicht fest. Doch nicht nur Italiens Motorradfans sind felsenfest davon überzeugt: MV Agusta ist unsterblich.
Benelli

Vittorio Merloni, Boss des Haushaltsgerätekonzerns Indesit, hatte es auch nicht leicht: Einer seiner Söhne investierte Mitte der 90er-Jahre viel Geld in eine italienische Motorrad-Website, der andere, Andrea, noch mehr in den Versuch, die alte Marke Benelli aus Pesaro an der Adria wiederzubeleben. Zunächst sogar mit Erfolg: Der Supersportler Tornado, ein 900er-Dreizylinder, machte Furore, weitere Modelle folgten. Doch die Motorräder kämpften mit technischen Problemen, auch die Rollerproduktion warf kaum Gewinne ab. 2005 stellte Benelli die Produktion ein und wurde kurz darauf von der chinesischen Gruppe Quijiang (QJ) übernommen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Marke bereits eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Gegründet wurde sie 1911 von den sechs Brüdern Benelli, zunächst als Werkstatt. Die Motorradproduktion begann 1921 mit einem Zweitakter mit 98 cm3. Bald darauf startete Tonino Benelli auf den hauseigenen Motorrädern im Rennsport; dank der Erfolge stieg die Nachfrage, 1930 arbeiteten 1000 Menschen im Werk. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zwischen den Brüdern beziehungsweise ihren Erben zu Streitigkeiten, 1972 wurde die Firma an den Argentinier Alejandro de Tomaso verkauft. Der ließ immerhin den legendären Sechszylinder Benelli Sei entwickeln, versuchte später aber, die Motorräder von Benelli und seiner weiteren Marke Moto Guzzi mit den gleichen Teilen zu bestücken. Moto Guzzi überlebte knapp, Benelli nicht.
Heute, gut zehn Jahre nach der Übernahme durch die chinesische Gruppe QJ, baut Benelli vornehmlich günstige kleine Motorräder, hat aber angekündigt, auch den großen Dreizylinder bald wieder aufzulegen. Für Verwirrung sorgt aktuell die Insolvenzerklärung durch ein Gericht in Pesaro.
Moto Morini

Die Freunde der Marke versetzte es in helle Aufregung: Am Neustart von Moto Morini im Jahr 2005 war auch Franco Lambertini maßgeblich beteiligt. Der renommierte Entwickler hatte für die Marke bereits Anfang der 70er-Jahre die allseits bewunderte 3½ entworfen; nun baute er für die neue Firma Moto Morini einen extrem kurzhubigen 87-Grad-V-Motor mit 140 PS. Moto Morini, so schien es, war damit bestens aufgestellt für die Erfordernisse des modernen Motorradmarkts.
Doch es kam anders. Die Morini-Modelle heimsten zwar für Qualität, Performance und speziell den bärigen Motor viel Lob ein, aber in der Finanzkrise ging der Marke, die mehrere Verwandte des ursprünglichen Firmengründers gemeinsam mit drei Partnern wiederbelebt hatten, die Puste aus. 2010 musste Morini Insolvenz anmelden. Der Traum, in Bologna eine zweizylindrige Konkurrenz zu Ducati zu etablieren, war ausgeträumt.
Ihr erstes Leben hatte die Marke 1937 begonnen, gegründet von Alfonso Morini. Die ersten Motorräder entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, bei uns am bekanntesten wurde die 3½. 1987 kauften die Brüder Castiglioni nach der Marke Ducati auch Morini, wenige Jahre später wurde die Produktion eingestellt.
Heute gehört Moto Morini einer Finanzierungsgesellschaft und produziert homöopathische Stückzahlen in einem kleinen Werk nahe Mailand. Mangels ABS und Euro 4-Homologation dürften die Modelle aber bald ganz vom Markt verschwinden.












