Höher, schneller, weiter – der Aufrüstungswahn im Motorradmarkt war anno 1978 in vollem Gange, als in Japan einige mutige Entscheider und Modellplaner beschlossen, diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ beschwor man bei Yamaha das pure Fahrerlebnis. Weniger Zylinder, weniger Hubraum, weniger Leistung – ein 500er-Einzylinder mit 27 PS im simplen Stahlrohrrahmen sollte genügen, um den Fahrspaß auf zwei Rädern genießen zu können - die Yamaha SR 500 . Den passenden Motor hatte man ja bereits, er steckte bislang im Enduro-Fahrwerk und verhalf schon dem Schwestermodell XT 500 zu beachtlichem Erfolg.
Mehr Schwungmasse für besseren Durchzug
Ganz unverändert übernehmen konnte und wollte man diesen jedoch nicht, ein paar Modifikationen musste der simple Zweiventiler schon über sich ergehen lassen, um für den geänderten Einsatzbereich gewappnet zu sein. Für die Yamaha SR 500 weisen Zylinder und Kopf größere Kühlrippen auf, der Kolbenbolzen wurde verlängert, die Kurbelwangen sind um sechs auf 149 Millimeter gewachsen, mehr Schwungmasse sollte besseren Durchzug erzielen. Der Kupplungskorb wurde verstärkt, um höheren Dauerdrehzahlen standzuhalten, die Lagerung der Schaltwalze zwecks besserer Schaltbarkeit modifiziert. Nicht zuletzt kam ein neuer Vergaser zum Einsatz, und das Einlassventil wuchs im Durchmesser. Man hat also nicht einfach nur den XT-Motor in ein für den Straßenbetrieb modifiziertes Fahrwerk (steiler stehende Gabel, Rahmenrohre mit größerer Wandstärke und an den Knotenpunkten mit Blechprofilen verstärkt) gesteckt, sondern durchaus Aufwand für die Anpassung der Maschine an die neuen Anforderungen getrieben.
Für den deutschen Markt stimmten die Ingenieure den Einzylinder auf versicherungsgünstige 27 PS ab, die ungedrosselte Version der Yamaha SR 500 leistete zu Beginn 33 PS. Wer umrüsten und die volle Power zur Verfügung haben wollte, musste nur den Ansaugstutzen mit größerem Querschnitt einbauen und die Bedüsung des Mikuni-Vergasers anpassen. Der grundsätzliche Charakter des Motors änderte sich nicht dramatisch, doch die Fahrleistungen legten messbar zu: Eine Sekunde schneller von null auf 100 km/h und zehn Sachen höhere Spitze sind nicht völlig zu verachten. Vor allem passte nun die Übersetzung, für die 27-PS-Variante war diese nämlich nicht geändert worden und erschien etwas zu lang, vor allem im Zweipersonenbetrieb oder bei langen Anstiegen.
Auch die Anbauteile der neuen Yamaha SR 500 sind zu weiten Teilen bekannt, stammen sie doch von beliebten anderen Yamaha-Modellen. Gabel, Lenker und Schutzblech verrichteten beispielsweise schon bei der XS 650 ihren Dienst. Apropos Dienst: Wer den Single morgens wachrütteln und zur Aktivität bewegen will, kann nicht entspannt aufs Knöpfchen drücken, sondern muss per Muskelkraft und unter Einhaltung einer exakten Vorbereitung der Startzeremonie richtig körperlich tätig werden. Auch das gehört schließlich zum puristischen Gedanken.
Herrliche Kickstart-Mythen
Herrliche Gerüchte rankten sich um die angeblich so schwierige Startprozedur per Tritt auf den Kickstarter, Horrormärchen verbreiteten sich an den Stammtischen, von zurückschlagenden Kickstartern, die leichte Fahrerinnen in hohem Bogen übers Garagendach schleuderten. Klar, XT und somit auch Yamaha SR 500 galten, oder sollten als echte Männermotorräder gelten. Für harte Kerle, und nur von solchen in Gang zu bringen. Halbherzige Startversuche sollen angeblich auch mal zu lädierten Waden und verletzten Sprunggelenken geführt haben. Geschichten, die sich teilweise bis heute halten und wohl mit zum Ruf der Yamaha SR 500 als urwüchsiges, kerniges Motorrad beigetragen haben.
In Wahrheit sprang und springt der 500er bei richtigem Umgang meist auf den ersten, spätestens beim dritten Tritt an. Das untermauert auch der Kommentar im ersten Test in MOTORRAD: „Wenn der Motor beim dritten Tritt nicht läuft, ist irgendetwas faul. Entweder mit dem Einzylinder oder dem rechten Bein.“ Schließlich macht die Yamaha SR 500 es dem Fahrer ja mittels eines Fensters oben im rechten Nockenwellengehäuse und einer weißen Markierung auf der Nockenwelle recht leicht, die passende Stellung des Kolbens knapp hinter dem oberen Totpunkt zu finden, auf die ein „respektloser Tritt“ zu folgen hat, worauf der Eintopf in aller Regel die Arbeit aufnimmt.
Der Motor gibt sich stets ungeniert
In Sachen Lebensäußerungen gab sich der Motor stets ungeniert: Wo verbrannt wird, darf auch vibriert werden, scheint sein Motto zu lauten. Ausgleichswelle? Gab’s nicht. Wozu auch. Den Eintopf darf und soll man spüren, und zwar in unterschiedlichen Drehzahlbereichen ganz unterschiedlich intensiv. Ab etwa 2500/min läuft der Motor zwar rund, doch knapp darüber, bei rund 3000/min erreichen die Vibrationen in Fußrasten und Lenker ihren ersten Höhepunkt. Darüber kommt die Wohlfühlzone, doch ab rund 5500/min werden die Vibrationen richtig grob, hohe Dauerdrehzahlen mögen aber sowieso weder SR-Motor noch -Fahrer. Der sprichwörtliche Bums unten und in der Mitte törnt die Liebhaber der Yamaha SR 500 schon immer an, auch wenn er subjektiv eher berauscht als messbar beeindruckend ist.
Den Referenzberg locker mit 100 Sachen hoch
Auch mein erster Kontakt mit dem 500er-Dampfhammer, so zumindest kam er mir damals vor, fand irgendwann im Sommer 1982 statt. Gerade 18 geworden und den Führerschein Klasse eins und drei in der Tasche, fuhr ich noch immer meine 80er, ein Honda MT 8. Mein erstes Auto stand vor der Tür, der Opel Kadett B, ein Geschenk meiner Tante, die sich einen neuen Kleinwagen zugelegt hatte. Durchaus vom Rost befallen, die Kiste, aber sie fuhr und hatte TÜV. Auto und Motorrad zugleich war als Schüler erst mal nicht drin, so nahm ich das Angebot des ein Jahr älteren Kumpels gern an, hie und da mit seiner XT 500 (mit offenen, aberwitzigen 34 PS) durchs Dorf zu ballern. Den Referenzberg am Ortsausgang, den die Achtziger im Vierten mit Mühe und Tacho 60 schaffte, zog die XT locker mit 100 Sachen hoch und hatte noch Reserven. Sackzement, was für einen Druck das Ding hatte!
Die XT und ihr Motor hatten ihren Ruf schnell weg. Vor allem trennte er ja angeblich schon beim Startversuch die Männer von den Memmen. Die bereits erwähnten Schauermärchen machten auch bei uns die Runde. Papperlapapp – unser noch jugendlich forscher Drang ließ schnell die Idee reifen, auf echt harte Kerle zu machen. „So ‘ne XT, die werf ich dir mit der Hand an.“ Große Worte von halbstarken Jungs. Doch wir sollten recht behalten. Mit der richtigen Vorbereitung (Deko-Hebel ziehen, Kolben korrekt über den oberen Totpunkt gepumpt) und energischem Druck mit der Rechten (nur nicht halbherzig) gelang das Vorhaben. Jedenfalls einigen von uns.
Aus der 2J4 wurde die 48T
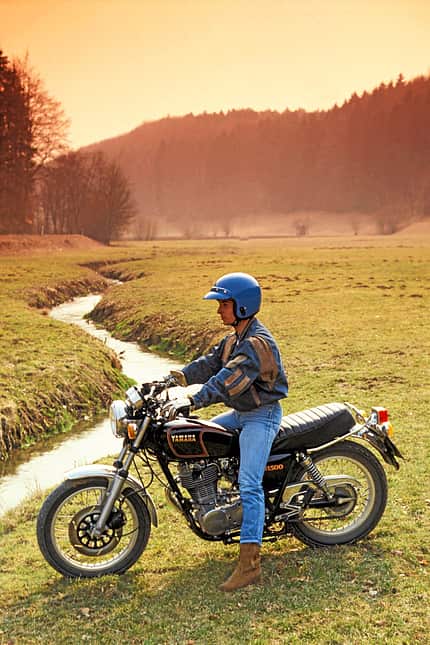
Wenn man heute von der japanischen Lady spricht, kommt gelegentlich unsicheres Nachfragen: Yamaha SR 500 – ist das nicht die mit dem riesigen Scheinwerfer? Jein. Den mächtigen Rundscheinwerfer mit 200 Millimetern Durchmesser trugen lediglich die Modelljahre 1979 bis 1983. Da vor allem die frühen Baujahre mit satten Verkaufszahlen auftrumpfen konnten, prägten diese Modelle mit ihrer großen Verbreitung lange das Bild von der SR auf deutschen Straßen. 1984 verschwand übrigens nicht nur der Kochtopfgroße Scheinwerfer, es fand nach diversen kleinen Änderungen und Verbesserungen (die optionalen Gussräder ab 1979 hatten sich als Flop erwiesen) die erste umfassende Modellpflege statt. Auch das Typkürzel änderte sich – aus der 2J4 wurde die 48T, wie sie auch bis zum Ende der Bauzeit heißen sollte.
Das kleinere 18-Zoll-Vorderrad verbesserte das Handling, ohne die Stabilität zu verwässern, ein schmalerer Lenker löste die breite, höhere Segelstange ab. Der Plastikheckbürzel verschwand, ein Schmiernippel an der Schwingenachse und eine pflegeleichte, haltbarere Kette mit O-Ringen hielten endlich Einzug. Dem hohen Ölverbrauch sollte ein modifizierter Ölabstreifring, den Haltbarkeits-Problemen mit dem Ventiltrieb eine Ölsteigleitung zum Auslassventil Einhalt gebieten. Eine neue Nockenwelle mit mehr Hub sowie das vergrößerte Volumen von Auspuff und Luftfilter bescherten dem Motor ein PS Mehrleistung auf nun (offene) 34 PS. Sicherlich nicht kriegsentscheidend, doch angesichts dessen, was da ab 1991 noch kommen sollte, ein Höhepunkt in der SR-Geschichte.
Yamaha SR 500 als Reisegefährt

Viel wichtiger erschien sicherlich vielen SR-Treibern, die ihren Eintopf auf langen Touren als Reisegefährt schätzen gelernt haben, die Erhöhung des Tankvolumens von 12 auf 14 Liter (1987), was die Reichweite auf praktikablere Werte ansteigen ließ. Wobei der 500er nie als Schluckspecht galt – artgerecht bewegt, genehmigt er sich zwischen 3,5 und 4,5 Liter auf 100 Kilometer, über fünf Liter nur in Extremfällen. Reisen war und ist mit der Yamaha SR 500 durchaus möglich, auch mit Beifahrer, der ab 1984 ein noch besser gepolstertes Plätzchen vorfindet. Angesichts der Zuladung von rund 220 Kilogramm bleibt noch Spielraum für Gepäck. Wobei die Federelemente, insbesondere die Federbeine, dann gnadenlos überfordert sind. Die meisten Fahrer haben sie aber ohnehin schon frühzeitig gegen Konis ausgetauscht. Für Fernreisen gibt es aber sicher geeignetere Bikes, mag der eine oder andere nun einwenden. Sicher. Nicht alle SR-Fans sind Weltenbummler.
Zurück zum stressfreien Fahrgenuss
Was sind es denn eigentlich für Leute, die SR fahren? Das Klischee vom armen Studenten, der sich nur dieses „Brot-und-
Butter-Motorrad“ leisten kann statt einer Ducati, von der er eigentlich träumt, mag hier und da zugetroffen haben. Doch es waren und sind ganz verschiedene Typen, die sich meist sehr bewusst entschieden haben, ehe sie dem Charme der Yamaha SR 500 erlagen. Aufsteiger von MZ-Zweitaktern, Gemütsmenschen, denen der charakterlich leicht britisch angehauchte Single völlig genügte, entnervte oder überforderte Mehrzylinderbesitzer, die wieder zurück zum stressfreien Fahrgenuss streben. Und jene Vielfahrer und Reisende, die des Schraubens mächtig sind und unterwegs am liebsten alles selbst reparieren wollen – und bei der SR auch können.
Darüber hinaus gibt es ja, neben denen, die die SR genau so lieben, wie sie ist, auch die Bastler, Umbauer und Veredler, die in der Yamaha SR 500 eine ideale Grundlage für den Traum vom Eigenbau sehen und aus dem klassischen Roadster einen Café Racer, einen Dirt Tracker oder ein wie auch immer geartetes individuelles Bike kreieren. Eine ganz besondere Szene entstand, die der legendären Yamaha SR 500 auf ihre ganz eigene Art huldigt.
Ab 1991 Einzylinder nur noch mit 23 PS
Rennen gewinnen konnte und wollte die Yamaha SR 500 schon früher im Alltag nie, doch spätestens ab Modelljahr 1991 war dieses Vorhaben endgültig passé. Die strengen Abgas- und Geräuschvorschriften zwangen die Konstrukteure zu unliebsamen Maßnahmen, welche die Leistung des Singles auf 23 PS abwürgten. Entdrosseln auf 27 PS wurde zwar im Nachhinein legal möglich, mehr geht jedoch definitiv nicht. Von offenen 33 beziehungsweise 34 PS dürfen Besitzer jüngerer SR-Exemplare also nur träumen.

Ab 1992 entfiel auch noch die Scheibenbremse vorn, es gab nur noch die bereits zuvor optional angebotene Trommelbremse, die den nostalgischen Touch der Yamaha SR 500 betonen sollte. Ein Wunder an Wirksamkeit ist diese jedoch nicht. Das letzte Aufbäumen führte 1998 noch zu einem limitierten Anniversary-Modell, quasi zum 20. Geburtstag. Ein Jahr später sollte Schluss sein. Zumindest als Neufahrzeug in Deutschland.
Die Yamaha SR 500 erfreut sich dennoch, oder gerade deswegen, noch immer großer Beliebtheit, dies zeigt sich auch an den stolzen Gebrauchtpreisen für gut erhaltene Original-Exemplare der ersten Baujahre. Neu zu kaufen gibt es sie, wie erwähnt, hierzulande seit 1999 nicht mehr, in Japan hingegen lebte sie weiter und ist als 400er noch heute nagelneu zu bekommen. Mögen die Gerüchte stimmen, die besagen, Yamaha überlege stark, die SR 400 angesichts des 35-jährigen Jubiläums auch in Europa anzubieten. Die SR-Fan-Gemeinde, und viele, die vermutlich neu dazu stoßen würden, dürfte dies sicher freuen. In Zeiten von 200-PS-Racern und 400-Kilo-Cruisern täte die Existenz solch eines puristischen, ehrlichen, klassisch schönen Bikes wie der SR (egal, ob 400 oder 500) einfach gut.
Die Technik

Eines der Erfolgsgeheimnisse der Yamaha SR 500 ist ihr technisch vergleichsweise simpler Aufbau und ihre Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit. Was sie jedoch nicht frei von Schwächen oder Änfälligkeiten macht. So mag sie weder Dauervollgasbetrieb noch nachlässige Wartung. Generell verlangt der Einzylinder in der Regel nach spätestens 30.000 Kilometern eine Überholung von Kolben, Zylinder und oft auch des Zylinderkopfs.
Defekte Lichtmaschinen (bis 1983) und Vibrationsschäden an zahlreichen Anbauteilen sind ebenfalls typisch für die SR-Modelle. Diverse Modellpflegemaßnahmen, die wichtigsten 1984 beim Wechsel vom Typ 2J4 auf das Modell 48T, sowie deutliche Änderungen zum Modelljahr 1991 brachten Verbesserungen bzw. bremsten die Leistung des Singles ein. Hohe Ölverbräuche oder Defekte am Ventiltrieb konnten so weitgehend unterbunden werden, bis zuletzt geblieben sind die Gefahr vor Vibrationsrissen an allen möglichen Bauteilen und die Notwendigkeit, sich um die überforderten Federelemente zu kümmern.
Die besonders anfällige Lichtmaschine sollte bei älteren Modellen längst getauscht worden sein, ab 1980 zeigte sich diese ab Werk stabiler. Sie muss auch längst nicht mehr komplett getauscht werden (teuer), die Impulsspule (meist die Fehlerquelle) ist einzeln erhältlich. Teile oder überholte Limas gibt‘s zum Beispiel bei Motorradtechnik München. Apropos Teile und Hilfe: Spezialisten und Teileanbieter gibt es einige, Ersatz- und Umbauteile sowie Zubehör bietet zum Beispiel die Firma KEDO an, in Sachen Motor-Instandsetzung und Teileversorgung ist man bei Meinold Müller bestens aufgehoben (alle Kontaktdaten siehe „Spezialisten“).
Modellpflege
1978: Verkaufsstart des Urmodells Typ 2J4 mit 27 bzw. offen 33 PS
1979: Auf Wunsch Gussräder (150 Mark Aufpreis), neuer, großer Scheinwerfer mit 200 Millimetern Durchmesser, modifizierter Motorseitendeckel zur Sicherung des Wellendichtrings, Deckel des Ölpumpengehäuses mit fünf statt bisher drei Schrauben, Einbauspiel der Kurbelwelle reduziert, getrennte Impulsspule für Niedrigdrehzahlbereich
1980: Dickere untere Kühlrippen zur Versteifung des Zylinders, Verstärkung des Kickstarterfreilaufs, zusätzliche Rahmenbleche zwischen Steuerkopf und Öleinfüllstutzen, Blinker am Rücklichthalter befestigt
1981: Doppelwandiger Krümmer
1984: Gründliche Überarbeitung kennzeichnet das Modell 48T, mit 27 bzw. offen 34 PS. 18- statt 19-Zoll-Vorderrad mit geschlitzter Bremsscheibe, Felge hinten auf 2.15 Zoll verbreitert, Ölsteigleitung zum thermisch höher belasteten Auslass-
ventil, schmalerer Lenker, nun 170-Millimeter-Scheinwerfer, Schmiernippel an Schwingenachse, O-Ring-Kette, Entfall des Plastikbürzels an der Sitzbank, Kolben 25 Gramm leichter sowie mit geändertem Ölabstreifring, Zylinderkopfdichtung aus Metall, Nockenwelle mit 0,5 Millimeter mehr Hub, gehärtete Kipphebel samt Wellen, verstärkter Steuerkettenspanner, größeres Volumen von Luftfilter und Auspuff
1987: Tankvolumen auf 14 Liter erhöht
1988: Gegen Aufpreis wahlweise Duplex-Trommelbremse vorn
1991: Strengere Abgas- und Geräuschgrenzwerte bedingen eine Leistungsreduzierung auf 23 PS durch Änderungen an Kolben und Nockenwelle sowie Reduzierung der Verdichtung auf 8,3:1, neuer Flachschiebervergaser ohne Starthilfeknopf, kürzere Sekundärübersetzung; Entdrosselung auf 27 PS mit TÜV-Gutachten möglich
1992: Nur noch mit Trommelbremse vorn erhältlich
1993: Seitenständer mit Zündungs- Unterbrecherschalter
1998: Limitiertes Anniversary-Modell
1999: Abverkauf der letzten Exemplare
Gebrauchtcheck
Technisch weniger Versierte sollten zur Besichtigung einen Experten mitnehmen, der die mechanischen Geräusche des Singles beurteilen kann. Starkes Klappern deutet auf einen verschlissenen Kolben hin, lautes Klickern aus dem Zylinderkopf kann ein Indiz für einen verschlissenen Ventiltrieb sein, besonders bei Baujahren bis 1983.
Weitere Schwachpunkte des Einzylinders sind hoher Ölverbrauch, festgerostete Schwingenlager sowie defekte Lichtmaschinen, verschlissene Federbeine und diverse Vibrationsschäden an Krümmer (bis 1980), Deckeln und Haltern. Bei Modellen vor 1984 darauf achten, ob die Yamaha SR 500 idealerweise bereits auf die sogenannte Doppelschmierung (Direktschmierung des Auslassnockens) von Wunderlich umgerüstet sowie ein Kolben mit modifiziertem Ölabstreifring verbaut wurde.
Marktsituation
Die Yamaha SR 500 war ein echter Verkaufsschlager – insgesamt konnte Yamaha 38.328 Exemplare unters Volk bringen. Der Bestand heute liegt bei immer noch knapp 20.000 Maschinen, dem steht eine noch immer beachtliche Nachfrage nach Gebrauchten gegenüber.
Doch die Käufer sind wählerischer geworden, die Preise für Bastelkisten mit hoher Laufleistung sinken weiter, schon für weniger als 500 Euro kann man eine solche ergattern. Für gepflegte, technisch überholte Exemplare der ersten Baujahre (Modell 2J4) im Serienzustand werden inzwischen Sammlerpreise verlangt und bezahlt. Zwischen 2500 und rund 4000 Euro können sich die Preise hier bewegen, wobei eine klare Bewertung schwer zu leisten ist – hier heißt es einfach den Markt sondieren, vergleichen und auf das gewünschte Angebot (überholte 2J4 oder gut gepflegte 48T) warten.
Technische Daten
Daten (Typ 48T)
Motor: Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, zwei Ventile, über Kipphebel betätigt, Hubraum 499 cm³, Leistung 20 kW (27 PS) bei 6000/min (offen), Gleichdruckvergaser, Ø 34 mm
Kraftübertragung: Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb
Fahrwerk: Einschleifen-Stahlrohrrahmen mit einfachem, gegabeltem Unterzug, Telegabel vorn, Ø 35 mm, Zweiarmschwinge aus Stahl, zwei Federbeine, Drahtspeichenräder, Reifen 3.50 S18 vorn, 4.00 S18 hinten, Duplex-Trommelbremse vorn, Ø 200 mm, Simplex-Trommelbremse hinten, Ø 150 mm
Maße und Gewichte: Radstand 1405 mm, Gewicht vollgetankt 170 kg
Fahrleistungen: Höchstgeschwindigkeit 135 km/h
Spezialisten
Elektrik/Lichtmaschinen
Motorradtechnik München,
Telefon 089/50 63 63,
www.motorradtechnik-muenchen.de
Teile/Zubehör/Umbauten
KEDO in Hamburg,
Telefon 040/40 17 02 00,
www.kedo.de
Fa. Grobmotorik,
Tel: 0 22 02/24 34 49,
www.grobmotorik.org
Motorüberholung/Teile
Motorrad Müller in Beverungen,
Telefon 0 52 73/3 56 70,
www.motorrad-mueller.net
Clubs und Foren
www.sr500.de
www.sr-xt-500.de
Tests in MOTORRAD
5/1978 (T); 7/1979 (VT); 8/1979 (VT); 5/1982 (LT); 8/1982 (VT); 7/1983 (VT); 9/1984 (T); 16/1984 (VT); 13/1985 (VT); 9/1986 (VT); 12/1987 (VT); 5/1988 (MR); 8/1991 (T); 8/1992 (VT); 16/1992 (VT); 21/1993 (VT); 10/1995 (VT); 26/1998 (MR)
T = Test, VT = Vergleichstest, LT = Langstreckentest, MR = Modellreport













