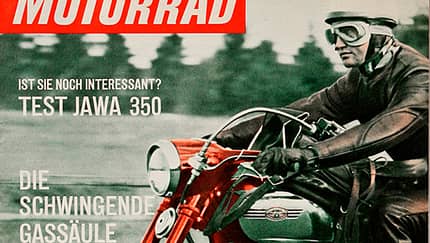Es war schon fast alles da im Herbst 1903: die Motorräder, ihre Fahrer, ihre Hersteller, deren Zulieferer. Die Annoncen, die eine Zeitschrift finanzieren helfen, ein Verleger, Redakteure, Experten als Gastautoren. Und so bot die Erstausgabe der neuen illustrierten Zeitschrift „Das Motorrad“ auf 20 Seiten plus vier Umschlagseiten bereits ein reichhaltiges Programm. In beeindruckend moderner Orthografie – um die Jahrhundertwende wurde auch gerne noch „illustrirt“ statt illustriert – legten Verlag und Redaktion ihre Ziele dar. Ingenieure lieferten Berechnungen zum Leistungsbedarf eines Motorrads oder regten den Einbau von „Frictionskupplungen“ zur Trennung von Motor und Antriebsrad an. Der Österreicher Heinz Kurtz schilderte eine „Bundes-Wanderfahrt“ auf seinem Neckarsulmer Motorrad, und ein nicht namentlich genannter Autor erklärt die Technik eines neuen Motors der Marke Fafnir.
In der „Umschau“ wird bereits ein Thema umrissen, das die frühen Jahre von „Das Motorrad“ beherrschen sollte: „unverständige behördliche Drangsalierungen“, die der Automobilindustrie angeblich schweren Schaden zufügten. 1906 wurde der Entwurf für ein neues Steuergesetz debattiert. „Das Motorrad“ bescheinigte dem „Regierungsentwurf seinen völligen verblüffenden Mangel an jeder Sachkenntnis“. Tatsächlich brachen als Folge einer Wirtschaftskrise, verstärkt durch die neue Steuer, die Verkäufe von Motorrädern und Zeitschrift ein. Verleger Paul Förster sah sich genötigt, die Zeitschrift in „Das Automobil“ und kurz darauf taktisch klüger in „Der Motor“ umzubenennen – nach dem Vorbild einer erfolgreichen britischen Zeitschrift. Doch es half nichts. 1907 wurde „Der Motor“ eingestellt.
1919 bis 1933
Nach dem Ersten Weltkrieg und den Wirren der unmittelbaren Nachkriegszeit nahmen Motorrad und Automobil wieder Fahrt auf, und in ihrem Gefolge blähte sich die Bürokratie. Ob Zollerhöhung, Haftpflichtversicherung, Benzinsteuer, Rückstrahler oder das hintere Nummernschild – viele Aufmacher der in Berlin neu gegründeten Fachzeitschrift „Das Motorrad“ drehten sich um behördliche Auflagen und Pläne. Vor allem die Haftpflicht war ein neues Konzept, das für Empörung sorgte: „Der böse Paragraph 7“, titelte die Redaktion 1929, verpflichte den Halter zu Schadenersatz, „auch wenn du unschuldig bist“.
Die Regelungswut hatte Gründe: Der Bestand an Krafträdern wuchs im Lauf des Jahres 1925 um 75 Prozent auf 216 829 Stück. Bereits im Februar 1926 mokierte sich „Das Motorrad“ über einen „unerhörten“ Steuerplan. Für jede Pferdestärke sollten 20 Reichsmark fällig werden. Obendrein gab es eine Umrechnungsformel für preiswertere Zweitakter, die diese gegenüber Viertaktern benachteiligte: „…für eine 2pferdige DKW-Maschine müßte genauso viel bezahlt werden, wie für eine überkomprimierte 5pferdige Supersportmaschine, die ein Luxusgegenstand für den ausgesprochenen Sportsmann darstellt.“ Was die Definition eines Supersportlers betrifft, haben sich die Zeiten entscheidend geändert.
Schließlich wird 1928 ein neues Steuergesetz eingeführt, das wie heute noch den Obulus nach dem Hubraum ausrichtet. Unter 200 cm³ und 350 Kilogramm waren Motorräder und Dreiräder steuer- und führerscheinfrei: „…das wird dazu beitragen, die Motorisierung des deutschen Wirtschaftslebens in hohem Maße zu beschleunigen“, frohlockt „Das Motorrad“ am 31. März 1928. Die Vorhersage erwies sich als wahr: Der Bestand stieg von 438288 Motorrädern 1928 auf 606400 Stück 1929, die Mehrheit davon Krafträder bis 200 cm³. Dabei hatten Käufer die Wahl unter 62 deutschen Motorradmarken von Arge bis Zündapp – dazu kamen noch britische, US-amerikanische und französische Hersteller.
"Die Motorradfahrer Berlins sind in Aufregung"
Der Boom führte zu Problemen: „Die Motorradfahrer Berlins sind in Aufregung. An allen Ausfahrtsstraßen stehen am Sonntag morgen Polizei-Patrouillen in Begleitung amtlicher Sachverständiger und halten jeden Motorrad-Fahrer an, der mit rauchender und knatternder Maschine ins Freie zieht“, schreibt Chefredakteur Paul Friedmann und verurteilt die „Rowdys der Landstraße“ im September 1928 im Artikel „Unnötiger Lärm“. Dabei scheinen die bösen Buben hauptsächlich die zu sein, die Bikes bis 200 cm³ bewegen. „Es ist nicht unbedingt nötig, dass ein steuerfreies Rad wie ein hundertpferdiger Mercedes-Kompressor harmlose Passanten erschreckt“, moniert „Das Motorrad“. Und: „Es propagiert auch nicht den Motorradsport, wenn alle schalldämpfenden Flächen und Siebe aus den Auspufftöpfen entfernt werden…“
Viele Leserbriefschreiber regen sich über das gleiche Thema auf: „Immer wieder wird aus dem Publikum die Klage laut, dass der Motorradfahrer ein lästiger und gefährlicher Geselle der Straße ist“, so ein Leser, der sich über Geknatter, „unnützes Laufenlassen der Maschinen auf Stand mit Vollgas und das unnütze Benutzen des Kurzschlußknopfes“ erregt. Die Forderung, den Führerschein für Maschinen unter 200 cm³ wieder einzuführen, wird laut. Viele Leser grenzen sich von den „wilden“ Motorradfahrern ab. „Das Motorrad“, das sich ebenfalls um den schlechten Ruf der deutschen Fahrer und steigende Unfallzahlen sorgt, dreht den Spieß im November 1929 um: „Nicht der deutsche Kraftfahrer, sondern die deutsche Gesetzgebung ist schuld. Hört endlich damit auf, jeden Schritt und jeden Handgriff der Kraftfahrer in Paragraphen zu fassen.“
1933 bis 1943
Das wichtigste Thema für die Redaktion war im Frühjahr 1933 – nein, nicht der Machtantritt der Regierung Hitler, sondern die Internationale Automobil- und Motorrad-Ausstellung, kurz IAMA, in Berlin. Fünf Ausgaben lang berichtete das Blatt von der Messe, für die es „viereinhalb Jahre lang gekämpft hatte.“ Der Grund für diese Initiative liegt in der Wirtschaftskrise. Massenarbeitslosigkeit hatte die Verkaufszahlen von Kraftfahrzeugen abstürzen lassen, auch die Auflage der Zeitschrift hatte einen steilen Sinkflug hinter sich. Die IAMA sollte der Branche Auftrieb geben.
Der neue Reichskanzler Adolf Hitler hielt die Eröffnungsrede eher zufällig – wegen einer Erkrankung des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Hitler verkündete ein Vier-Punkte-Programm zur Förderung der Kraftfahrt, das bereits zuvor vom Finanzministerium entwickelt worden war. Als wichtigsten Punkt sah es die Abschaffung der Kraftfahrzeugsteuer für alle Neufahrzeuge vor, die nach dem 31. März 1933 zugelassen wurden.
Kein Wunder, dass Paul Friedmann in seinem Leitartikel der Ausgabe 12/1933 das Programm enthusiastisch feierte – und mit ihm seinen Verkünder. Eine böse Ironie der Geschichte, denn Hitler gebührt an diesem Programm nur das Verdienst, es sich zu eigen gemacht zu haben, und das Lob Hitlers bewahrte Paul Friedmann nicht davor, wegen seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland fliehen zu müssen. Im Frühjahr 1933 übergab er die Chefredaktion an seinen engen Mitarbeiter Gustav „Gussi“ Müller, lieferte aber weiterhin Beiträge. Ab der Ausgabe 36/1933 taucht Paul Friedmann als Autor nicht mehr auf.
Wachsender Druck des NS-Regimes
Trotz etlicher Lobpreisungen Hitlers in den Folgejahren, und obwohl ein Porträt des Diktators sogar den Titel der Ausgabe vom 3. Februar 1934 einnahm, wäre es falsch, Gustav Müller als Nationalsozialisten zu bezeichnen. Er war wahrscheinlich ebenso wenig einer, wie Paul Friedmann anfangs ein Gegner des Nationalsozialismus gewesen war. Beide sind jedoch Beispiele dafür, wie leicht eine unpolitische Haltung zu erschüttern ist, wenn politisches Bewusstsein gefordert ist. Bis kurz nach der Reichstagswahl vom 31. Januar 1933 hatte „Das Motorrad“ Fragen der Politik nur in engem Zusammenhang mit seinem Gegenstand behandelt. Danach mussten die Redakteure erkennen, dass der scheinbar unpolitische Charakter dieses Gegenstands sie nicht vor dem wachsenden Druck des Regimes schützen konnte. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns – nach dieser Maxime zwingen Diktaturen noch heute die Unpolitischen auf ihre Seite und geben die Unbequemen der Verfolgung preis. Gustav Müller und seine Kollegen hatten nicht die Kraft, dagegen aufzubegehren.
Zunächst ging es ja auch aufwärts. Steuererleichterungen, Autobahnbau (noch von Paul Friedmann freudig begrüßt) und Rüstungsaufträge kurbelten die Konjunktur an, der Motorradbestand stieg zwischen 1933 und 1938 von etwa 420 000 auf 760 000 Maschinen. Gustav Müller betrieb „Das Motorrad“ zunehmend mit freien Mitarbeitern, und einer von ihnen, Helmut Werner Bönsch, brachte eine Entwicklung in Gang, die bis heute die Zeitschrift bestimmt. „Ich war der Rechner in dem Team, sammelte Daten und Zahlen, traute keiner Angabe, wenn sie sich nicht nachrechnen oder nachmessen ließ.“ Also schuf der Rechner Bönsch eine neue journalistische Gattung: „Das Motorrad prüft“. Daraus entwickelte sich ein standardisiertes Test- und Messprozedere. Selbst ein Fahrtenschreiber wurde 1935 bereits eingesetzt. Leider sprengte gleich der erste Kandidat, eine BMW R 17, mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h den Messbereich des Instruments. Obgleich die Testarbeit in den kommenden Kriegs- und Nachkriegsjahren unterbrochen wurde oder in der Motorradkrise der 60er-Jahre fast zum Erliegen kam, zieht sich die Entwicklungslinie bis zum 1000-Punkte-Test heutiger Tage durch.
Das Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps NSKK, die Motor-HJ oder Motor-SS und ihre Sportwettbewerbe durchzogen die Ausgaben dieser Jahre, und wie bereits in MOTORRAD 17/2012 erwähnt, sorgte auch die um Aufträge der Wehrmacht buhlende Industrie für eine allmähliche Militarisierung von „Das Motorrad“. In der Ausgabe 13/1935 prüfte Helmut Werner Bönsch eine Imperia 350 Wehrsport, die zwarin dieser Form niemals in Serie ging, aber der Wehrmacht als Militärmaschine angedient werden sollte.
Aus dem Wehrsport wurde bald blutiger Ernst. Nach und nach zog die Wehrmacht die Mitarbeiter von „Das Motorrad“ zum Kriegsdienst ein. Christian Christophe, „Crius“, blieb wohl wegen seiner französischen Herkunft verschont und führte das Magazin mithilfe von Ernst Rosemann und Siegfried Rauch bis ins Frühjahr 1943 weiter. Schon im Jahr 1942 bestand das Leseangebot zu großen Teilen aus Erinnerungsoptimismus: „So siegten wir“ – unter diesem Titel referierte Rosemann in mehreren Fortsetzungen die Erfolge deutscher Rennfahrer. Die Titelillustrationen folgten den Vorgaben des Propagandaministeriums und dem Kriegsverlauf. Lichte, sandfarbene Aquarelle von durch die Wüste kurvenden Motorrädern begleiten die anfänglichen Erfolge Erwin Rommels in Nordafrika. Später im Jahr, wohlgemerkt noch bevor in Nordafrika und Stalingrad alles schiefzulaufen begann, nahm der Illustrator den Kriegsverlauf gar vorweg. Die Anmutung der Titelaquarelle schlug ins Düstere um. Als Beispiel sei hier der Titel der Ausgabe vom 19. Oktober 1942 gezeigt. Er scheint einer Ahnung bevorstehenden Grauens entsprungen; die starren Gesichter der drei Soldaten im BMW-Wehrmachtsgespann sollten wohl Entschlossenheit und Härte suggerieren, wirken aber wie Totenmasken.
1949 bis 1969
Kurz und betont unsentimental gedachte Gustav Müller in der ersten Nachkriegsausgabe von 1949 seiner im Krieg gestorbenen Kollegen. Vom Berliner Koenig-Verlag war „Das Motorrad“ an den von Paul Pietsch und Ernst Troeltsch neu gegründeten Motor Presse Verlag verkauft worden und nach Freiburg, später Stuttgart, umgezogen. Gustav Müller wollte weitermachen wie vor dem Krieg und war sich sicher, dass sich „junge Kräfte neben den „guten alten Namen in die Reihe stellen“ würden. „Das Spiel kann beginnen“ – so schloss sein Leitartikel, doch er selbst starb bereits im folgenden Jahr.
Sein Nachfolger Carl Hertweck hatte aus der Erfahrung von Diktatur und Krieg eine andere Vorstellung von Journalismus entwickelt als diejenige, weiterzumachen wie zuvor. „Wenn Hertweck eine Uniform sah, sah er er rot,“ berichtet Hans-Joachim Mai, damals Jungredakteur bei „Das Motorrad“. Carl Hertweck kroch vor keiner Autorität zu Kreuze und eckte damit in der autoritär geprägten jungen Bundesrepublik gewaltig an. Es kam wohl kaum eine Ausgabe an den Kiosk, in der er nicht einen Polizeipräsidenten, Sportfunktionär (15/1953), Politiker oder Industrieboss aufs Korn nahm. Manche Fehde, die er ausfocht, ist heute nicht mehr nachvollziehbar, etwa seine Polemik gegen das Rennsport-Engagement von NSU. Trotzdem war er kein Querulant. Er sah und kritisierte nur schärfer als viele andere und wurde nicht müde, jeden zu selbstständigem Denken aufzufordern, anstatt der deutschen Autoritätsgläubigkeit und Verbotskultur anzuhängen. 1958 hatte er an Ehren genug und an Feinden zu viele erworben und übergab die Chefredaktion an Siegfried Rauch.
Fahrtenschreiber bei Nürburgring-Testfahrten
Einer der von Gustav Müller erhofften Neuzugänge der Redaktion war im Frühjahr 1954 Ernst Leverkus. Vor schwierigen Aufgaben motivierte er sich selbst und andere mit dem Ausspruch „Das ist doch ein Klacks“, und weil es in den frühen 50er-Jahren offenbar viele schwierige Aufgaben zu bewältigen gab, entwickelte sich daraus sein Pseudonym. Der junge „Klacks“ trat zunächst als Fotomodell für Fahrmäntel in Erscheinung und in einem seiner ersten namentlich gezeichneten Artikel schon sehr selbstbewusst und meinungsstark auf. Die polemische Brillanz seines Chefredakteurs Hertweck stand ihm aber nicht zu Gebote. Sein großes Thema wurden die Tests: Er führte die Testfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife ein, und seine Beurteilungen gewannen dadurch enorm an Tiefe, dass alle Komponenten eines Motorrads bei diesem Fahrbetrieb weit über alltägliche Belastungen hinaus gefordert wurden. Auch nahm „Klacks“ die Idee des Fahrtenschreibers wieder auf, den er von 24 Stunden auf 24 Minuten Laufzeit pro Umdrehung umstellen ließ und mit wechselnden Übersetzungen dem Vorderradumfang verschiedener Motorräder anpassen konnte – ein frühes Data-Recording. Der Fahrtenschreiber wurde vor allem bei den Nürburgring-Testfahrten eingesetzt; bald ermöglichte ein großer Fundus von Datenblättern präzise Vergleiche.
Leider ging es nach dem Höhepunkt des Nachkriegsbooms im Jahr 1956 mit der Motorrad-Konjunktur mindestens genauso steil bergab wie in der Fuchsröhre des Nürburgrings. Bis 1970 sank der Bestand an Motorrädern von 2,5 Millionen Fahrzeugen auf etwa 300.000. 1959 hatte Ernst Wilhelm Sachs, damals Mitglied des Vorstands der Fichtel und Sachs AG, das Motorrad für tot erklärt. Ende 1962 erreichte auch die Auflage von „Das Motorrad“ mit knapp unter 30.000 Exemplaren einen Tiefpunkt. Es bedurfte der Weitsicht und Gelassenheit von Verleger Paul Pietsch, die Zeitschrift überhaupt fortzusetzen.
Ab 1969, Ende offen
Plötzlich war Farbe im Bild. „Das Motorrad“ verwendete sie zwar zunächst nur im Titelmotiv, doch der Wechsel von Ausgabe 3 zu 4/1970 erscheint wie ein Symbol der 70er-Jahre, die in Farbe geradezu explodierten. Schon in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre hatte sich Licht am Ende des Tunnels gezeigt, die ersten japanischen Motorräder verblüfften mit ungeheuren Drehzahlen und Literleistungen, es mehrten sich die Anzeichen, dass auch BMW neue Motorräder entwickelte. Früher als die Zulassungszahlen war auch „Das Motorrad“ aus der Talsohle gekrabbelt.
In Unkenntnis der früheren Vorläufer feierte die Redaktion 1969 das fünfzigjährige Jubiläum ihrer Zeitschrift, und „Klacks“ ahnte im Jubiläumsheft 22/1969 schon, aus welcher Ecke der Aufschwung kommen würde. Nicht diejenigen würden ihn bringen, die mit dem Motorrad zur Arbeit fuhren und dann bei wachsendem Wohlstand und erster Gelegenheit zum Auto wechselten. Die hatten nur einen „Zwischen-Boom“ ausgelöst, „etwas, was gar nicht zum Motorrad als Fahrzeug passte.“ Vielleicht – so sinnierte er – war die Krise danach sogar notwendig, um das Motorrad wieder zu seinem eigentlichen Selbst zu bringen: „ein sportliches Fahrzeug zu sein, das so viel Freude am Fahren vermittelt, daß darüber andere Punkte unwesentlich erscheinen.“
Nächste Fahrergeneration: die Baby-Boomer
Die Fahrergeneration, die bereit war, über die „anderen Punkte“ hinwegzusehen, musste allerdings erst noch heranwachsen. Das waren die Baby-Boomer, die in der Mehrzahl während der 60er-Jahre geboren worden waren und in den 70ern den Führerschein Klasse vier machten, um auf schnellen 50ern ihrem Traum von Freiheit und Fahrdynamik nachzujagen. „Jungs, eure 50er“ – die Serie mit dem unbefangen chauvinistischen Slogan begann mit Ausgabe 8/1970 und erschien in loser Folge.
Bevor Siegfried Rauch Ende 1976 in Pension ging, kappte er den Artikel: Die Zeitschrift heißt seit Ausgabe 18/1976 schlicht MOTORRAD. Der neue Chefredakteur Helmut Luckner machte die Serie für die Youngster zum Dauerbrenner, stellte junge Redakteure ein und surfte mit seiner Mannschaft auf dem Boom. Für die alte Garde war dies keine leichte Zeit, denn die Jungen lebten ihren Traum vom Motorrad ganz unbefangen anders aus, als es den alten Hasen gefiel. Rennfahrer wie Barry Sheene und Kenny Roberts waren Vorbilder für den Hanging-off-Stil, damals oft noch als „Bammelbein-Stil“ verächtlich gemacht. Unvermeidlicherweise stiegen mit dem Motorrad-Boom auch die Unfallzahlen. MOTORRAD musste zwischen der motorradskeptischen Attitüde der älteren Generation in der Politik und dem Enthusiasmus seiner jungen Leser vermitteln.
Die Jungen von damals stellen noch heute den Großteil der Leserschaft von MOTORRAD, ja der Motorradfahrer überhaupt. Und obwohl sie heute Heft und Maschinen besonnener und zurückhaltender kaufen als früher, ist doch eines sicher: Einen „Zwischen-Boom“ haben sie damals nicht entfacht. Der war von Dauer.