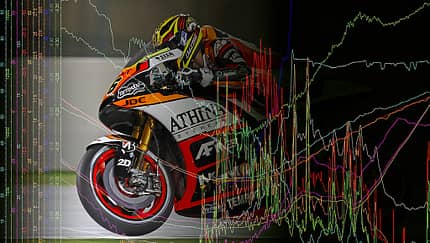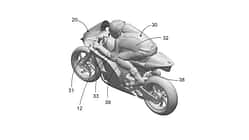Stefan Bradl biegt in die Boxengasse des Circuit de Catalunya nordwestlich von Barcelona ein. Bei seinem Team angekommen nimmt ihm ein Mechaniker das Motorrad ab und schiebt es rückwärts in die Garage. Blitzschnell werden die Reifenwärmer aufgezogen. So schnell, dass der Bridgestone-Techniker sie wieder etwas öffnen muss, um die Temperatur der Gummis messen zu können. Noch bevor sich bis zu vier Mechaniker kurz am Motorrad zu schaffen machen – und beispielsweise die Windschutzscheibe der Verkleidung putzen –, wird ein unscheinbares Kabel im Cockpit eingesteckt. Nach sechs Minuten fährt Bradl mit seiner zweiten Maschine wieder auf die Piste.
Die Szene spielte sich im Juni 2015 am Samstagvormittag beim dritten freien Training vor dem Katalonien-Grand Prix ab, als Stefan Bradl noch für das Forward-Team auf einer Yamaha nach Open-Reglement unterwegs war. Hätte er nicht das Motorrad gewechselt und wäre stattdessen mit dem weitergefahren, das er gerade an die Box gebracht hatte, wäre es ihm womöglich trotzdem völlig fremd vorgekommen. Denn in dem Moment, indem jenes Kabel eingestöpselt worden war, wurde die Yamaha zum Teil des Computernetzwerks seines Teams, ihre Steuerungselektronik zu einem Netzwerkgerät wie ein Drucker oder einer der Arbeitsplatzrechner der Forward-Techniker. Die haben sofort die Aufzeichnungen des Data-Recording-Systems heruntergeladen und wären genauso schnell in der Lage gewesen, die Motorsteuerung des Vierzylinders komplett umzuprogrammieren.
Motorsteuerung greift auf 5000 Parameter zurück
Bei seinem kurzen Stopp hatte Bradl nur wenige Worte mit seinem Crew-Chef Sergio Verbena, dem zuständigen Bridgestone-Reifentechniker und zuletzt mit Dirk Debus gewechselt. Debus ist der Mann, der mit seinem Kompagnon Rainer Diebold 1993 im Karlsruher Vorort Durlach die Firma 2D Data-Recording gründete. 2D hat die Software entwickelt, die den halbwegs komfortablen Umgang mit dem Datenwust, den einerseits das Data Recording erzeugt und der andererseits nötig ist, um die Aktionen der Motorsteuerung zu kontrollieren, überhaupt erst möglich macht.
EDV-Unterstützung ist an dieser Stelle bitter nötig. Damit die Motorsteuerung ihre Arbeit so machen kann, wie es von Fahrer und Technikern gewünscht wird, greift sie auf etwa 5000 Parameter zurück, die ihr aufgespielt werden – pro Set-up-Variante, versteht sich. „Und dabei bestehen manche Parameter nicht nur aus einem einzelnen Wert, sondern basieren auf einer umfangreichen Tabelle. Daher werden jedes Mal um die 10.000 Zahlen geändert, wenn etwas modifiziert wird“, sagt Dirk Debus.
Neue Software für 2016 ein Rückschritt?
Dass so viele Werte geändert werden müssen, liegt daran, dass Stefan Bradl, Debus und seine Mannschaft mit einem besonderen Handicap leben mussten. Bis Ende 2014 war Bradl zwei Jahre lang als Honda-Werksfahrer im LCR-Team mit der hochentwickelten Honda-Software für die Motorsteuerung verwöhnt worden. Dass der Honda-Rennabteilung HRC finanziell und personell kaum Grenzen gesetzt sind, ist am Ende tatsächlich für den Fahrer spürbar. Als Honda Bradl Ende 2014 fallen ließ, weil seine Ergebnisse die Erwartungen der Japaner nicht befriedigten, entschied er sich für den Wechsel ins Forward-Yamaha-Team und damit für ein drittklassiges Motorrad der Open-Kategorie, für das die Verwendung der Motorsteuerungssoftware des italienischen Herstellers Magneti Marelli obligatorisch war. Magneti Marelli wurde von MotoGP-Vermarkter Dorna als Lieferant für die Einheitssteuerung ausgewählt, die ab 2016 von allen – auch den Werksteams – verwendet werden muss.
Bei den ersten offiziellen Tests des Systems Ende 2015 machte es auf die MotoGP-Stars keinen guten Eindruck. Valentino Rossi oder Dani Pedrosa konstatierten gar einen technologischen Rückschritt um fünf oder mehr Jahre.
Bradl und Debus plagten sich indes schon Mitte 2015 mit einer noch weniger ausgereiften Version dieser Software herum. „Die Magneti Marelli-Motorsteuerung versteht ausschließlich die riesigen Datentabellen“, erklärt Debus, „eine Software, die den Umgang damit vereinfacht, gibt es von Magneti Marelli nicht.“ Deshalb mussten die einzelnen Werte in den Tabellen aufwendig von Hand angepasst werden.
"Das könnte Ärger geben"
Weshalb der riesige Aufwand? Weil es geht, weil es jeder macht und weil sich auch die eher klammen Privatteams einen möglichen Vorteil nicht entgehen lassen wollen. Nur ein Beispiel: Das Data-Recording erlaubt es, sich alle nur denkbaren Kenngrößen des Motorrads an jeder Stelle einer Rennstrecke im Detail anzuschauen. „Wenn Stefan berichtet, dass er in seiner ersten Runde in Kurve sieben gut zurecht kam, in der zweiten Runde aber einen Rutscher hatte, kann ich nachsehen, ob es da in einer Tabelle Unterschiede gab oder andere Gründe für den Rutscher, die auf das Konto des Fahrers gehen. Ich weiß, das gefällt Stefan nicht. Aber er akzeptiert es.“
Sollte Bradl das Gefühl bekommen haben, dass an einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Kurve mit dem Gemisch etwas nicht stimmt, kann er das von seinem Motorenmann ändern lassen. Der stellt mit Hilfe der Analyse-Software fest, in welchem Gang, mit welcher Gasgriffstellung und mit wieviel Drehzahl Bradl zum fraglichen Zeitpunkt gefahren ist. Dann werden für jeden einzelnen der vier Zylinder des Motors neue Tabellen erstellt, die dafür sorgen, dass bei dieser Kombination aus Gasgriffstellung, Gang und Drehzahl immer ein passendes Gemisch in die Brennräume geblasen wird. Wo exakt sich das Motorrad im entsprechenden Moment befunden hat, wird übrigens nicht per GPS ermittelt – das ist in der MotoGP-WM verboten –, sondern über die zurückgelegte Wegstrecke. „Die Ingenieure der Werksteams haben sich sogar Algorithmen ausgedacht, mittels derer berücksichtigt werden kann, wenn ein Fahrer eine andere Linie durch die Kurve wählt“, verrät Dirk Debus. Wie die genau funktionieren, sagt er nicht: „Das könnte Ärger geben.“
Die Maschine wird unfahrbar
Da sich die Elektronik nur an der gefahrenen Wegstrecke orientieren kann, muss sie darauf vertrauen, dass der Fahrer nicht vom vorgesehenen Weg abweicht. Tut er das doch, weil er sich beispielsweise verbremst und über eine Abkürzung oder einen Umweg auf die Strecke zurückkehrt, passen die Befehle der Motorsteuerung nicht mehr zum Streckenverlauf. Die Maschine wird unfahrbar, wenn nicht gar gefährlich.
Bei aller Computertechnik – ohne Menschen geht es im Motorradrennsport immer noch nicht. In Barcelona waren beim Forward-Team acht Personen für Stefan Bradl im Einsatz. Sergio Verbena, sein Crew-Chef und erster Ansprechpartner, die vier Mechaniker, die direkt am Motorrad arbeiten, in der Elektronikabteilung die beiden Italiener Alessandro Castagnetti und Luca Faso sowie der Deutsche Manfed „Tex“ Geissler. Wobei die italienischen Fachleute sowohl für Bradl als auch für dessen Teamkollegen Loris Baz arbeiteten. Castagnettis Aufgabe ist es, die Lebensäußerungen der Motoren zu überwachen. Läuft der Motor zu fett oder zu mager? Würde das Motorrad beim aktuellen Benzinverbrauch über eine Renndistanz kommen? Ist der Öldruck überall in Ordnung, funktioniert die Benzinpumpe richtig, gibt irgendwo ein Sensor seinen Geist auf oder erscheinen Anzeichen dafür, dass der Motor langsam kaputtgeht?
"Bei 5000 Parametern ist es leicht, etwas falsch zu machen"
Sollte Castagnetti entscheiden, dass eine magerere Motoreinstellung nötig ist, um über die Runden zu kommen, ist Luca Faso am Zug. Er ist der Mann für die Strategien, muss sich überlegen, wie er mit dem abgemagerten Gemisch klarkommt. Ist es nötig, die Traktionskontrolle anzupassen, weil der Motor insgesamt weniger Leistung liefert? Hat Stefan Bradl berichtet, dass die Traktionskontrolle im Kurvenscheitelpunkt gut arbeitet, beim Beschleunigen aber zu viel regelt? In welcher Kurve war das, in welchem Gang ist Stefan gefahren, wieviel Grad Schräglage hatte er und welche Maßnahmen würden Abhilfe schaffen? Sobald Faso eine Idee hat, setzt er sie in die Zahlenkolonnen für die Motorsteuerung um.
Die landen dann auf dem Bildschirm von Tex Geissler. Der ehemalige deutsche Motorrad-WM-Pilot, der sein bestes Ergebnis als Dritter beim 125-cm³-Nürburgring-GP 1997 feierte, hat den direktesten Kontakt zum Motorrad. Er ist dafür verantwortlich, dass die angelieferten Tabellen korrekt sind und auch ordnungsgemäß in die Motorradelektronik überspielt wurden. Dass im Motorrad mit dem Fahrwerks-Set-up für Regen auch die Motormappings für Regen drin sind. Dass Stefan Bradl unterwegs mit dem Schalter am Lenker auch die geplanten Voreinstellungen abrufen kann. „Da ist es bei 5000 Parametern ganz leicht, etwas falsch zu machen“, sagt Dirk Debus. Deshalb muss Geissler in erster Linie zuverlässig, ordentlich und fleißig sein. Motorsport-Background ist wichtig, denn Geissler sollte nicht nur verstehen, was die Tabellen bewirken, sondern auch wissen, was das für seinen Fahrer bedeutet und wie der damit umgehen kann. „Für Lucas Strategie-Posten braucht es einen studierten Ingenieur aus den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik“, erklärt Dirk Debus, „und für Allesandros Motormanagement-Job einen guten Techniker mit Computererfahrung.“
Was macht diese Software eigentlich?
Debus selbst steht nicht auf der Gehaltsliste des Forward-Teams, obwohl er in alle Überlegungen der Elektroniker mit einbezogen ist. „Wenn ich bei den Rennen mitmache, ist das gleichzeitig ein Praxistest unserer Software und Entwicklungsarbeit für 2D“, sagt Debus, „Für mich ist wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Techniker an einem GP-Wochenende arbeiten. Wie viel sie an diesen drei Tagen schaffen können, welche Voraussetzungen sie haben, was ich ihnen von Seiten der Software zumuten kann.“ Aus diesen Erfahrungen entstehen Ideen für neue Softwarefunktionen, die den Teams die Arbeit erleichtern.
Was macht diese Software eigentlich? Sie heißt „WinARace“ – „Gewinne ein Rennen“ und soll genau dabei helfen. Sie übersetzt die digitalen Informationen, die von den unzähligen Sensoren an so einem MotoGP-Motorrad über das Data-Recording als Zahlenwerte angeliefert werden, in eine analoge, grafische Darstellung und macht so den Sachverhalt viel einfacher erfassbar. Im Idealfall befreit sie den Techniker auch von der lästigen Aufgabe, die gewünschten Werte für die Programmierung der Motorsteuerung manuell in eine der großen Tabellen einzutragen oder sie dort ändern zu müssen. Stattdessen kann er den gewünschten Verlauf der Werte mit der Maus als Kurve zeichnen, die Software errechnet aus der analogen Darstellung die zugehörigen Werte und schreibt sie automatisch in die Tabelle. „Beim Gemisch sind wir schon so weit“, bestätigt Dirk Debus, „wir laden die im Training aufgezeichneten Lambda-Werte in unsere Software, sagen ihr, welche Werte wir haben wollen und lassen dann direkt die angepassten Tabellen erzeugen.“ Die im Abgas gemessenen Lambda-Werte geben Aufschluss darüber, wie mager oder fett der Motor läuft und wie gegebenenfalls die eingespritzte Kraftstoffmenge verändert werden muss, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.
"Es ist so ähnlich wie Radiohören"
Auch dieses Beispiel illustriert nur einen Bruchteil der Möglichkeiten, die das von Dirk Debus und Rainer Diebold entwickelte Softwarepaket bietet – allein die Dokumentation des Datenanalysemoduls (Software- und Dokumentations-Download unter www.2d-datarecording.com) umfasst knapp 100 Seiten. Kein Wunder, denn dahinter stecken mehr als 20 Jahre Erfahrung, in denen Debus auch selbst Motorradrennen gefahren ist. Die 2D-Lösung wird vom Yamaha-MotoGP-Werksteam, von KTM in der Moto3-Weltmeisterschaft und in der Formel 1 verwendet, in der Moto2-WM ist die zwischenzeitlich auf 30 Mitarbeiter angewachsene Firma Exklusivlieferant für die Data-Recording-Systeme. Dabei ist die 2D-Software nicht einmal übermäßig teuer und kostet in der Standardausführung 1500 Euro. Für die in der Moto2-Klasse obligatorische Kit-Version inklusive der ebenfalls von 2D hergestellten Sensoren gibt es je nach Anforderung der einzelnen Teams individuelle Arrangements.
Zum Glück muss sich der Fahrer im Sattel nur wenige Gedanken darüber machen, was alles im Hintergrund ablaufen muss, um ihm ein möglichst optimal abgestimmtes Motorrad hinzustellen. Stefan Bradl kann sich in einer vereinfachten Darstellung anschauen, wie es sich auf seine Rundenzeiten auswirkt, wenn er unterschiedliche Linien in den Kurven ausprobiert, härter bremst und beschleunigt oder versucht, möglichst rund um den Kurs zu kommen. Gravierenden Einfluss auf die Motorcharakteristik kann der Pilot während der Fahrt nicht nehmen. Es sei ähnlich wie Radiohören, sagt Dirk Debus. „Wir stellen ihm den Sender ein, und je nachdem, ob ihm die Musik gefällt, kann er sie lauter oder leiser machen. Die Traktionskontrolle in fünf Stufen, die Wheelie-Kontrolle und die Motorleistung in je drei Stufen. Aber wenn er einen anderen Sender hören will, muss er an die Box kommen.“ Die Kollegen von der Technik haben bestimmt etwas Passendes im Repertoire.
Interview Stefan Bradl

? Dass schnelle Motorradrennfahrer ein geniales Gefühl für ihr Motorrad haben, ist leicht nachvollziehbar. Müssen sie auch Computerfreaks sein, um die Möglichkeiten von Data-Recording und Motorsteuerung optimal nutzen zu können?
! Natürlich sind Computer bei Motorradrennen in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Aber ich bin damit aufgewachsen, Data-Recording gab es schon, als ich eingestiegen bin. Es ist wichtig, sich da auszukennen. Aber ein Fahrer muss kein Freak sein. Wir haben ja nicht direkt damit zu tun, sondern schauen uns die Daten gemeinsam mit den Ingenieuren an. Es kommt darauf an, gute Leute zu haben, die mir die Daten gut aufbereiten. Was ich brauche, um sie zu verstehen, habe ich mir „learning by doing“ angeeignet.
? Du hattest in den letzten Monaten mit drei verschiedenen Systemen zu tun: dem der Werks-Honda, einer Vorstufe des ab 2016 für alle vorgeschriebenen Magneti Marelli-Systems und zuletzt dem von Aprilia. Sind da Unterschiede zu spüren?
! Eigentlich spüre ich das beim Fahren nicht – mit Ausnahme des Magneti Marelli-Systems. Die perfekten Steuerungen arbeiten sehr sanft und akkurat, wenn das Motorrad beispielsweise rutscht oder das Hinterrad anfängt, durchzudrehen. Die nehmen dann nicht abrupt Leistung weg. Bei Honda bin ich da sehr verwöhnt worden, deshalb habe ich vielleicht auch mit der Magneti Marelli-Elektronik viele Probleme bekommen und so sehr gejammert. Mit der Aprilia-Lösung fühle ich mich wieder deutlich besser.
? Das Data-Recording gibt den Fahrern die Möglichkeit, mehrere Runden einer Trainingssitzung zu vergleichen und zu erkennen, wie sich eine bestimmte Fahrweise in einzelnen Kurven auf die Rundenzeit auswirkt. Musst du dir nicht unheimlich viel merken, wenn du diese Erkenntnisse nutzen willst, um eine ideale Runde zu fahren?
! Die ideale Runde gibt es nicht. Irgendwo ist immer ein Zentimeter oder eine Hundertstelsekunde, um die ich mich verbessern könnte. Die Hinweise aus dem Data-Recording auswendig zu lernen, hilft auch nicht. Es gehört eine Menge Intuition und Gefühl dazu. Wenn ich auf eine Rennstrecke komme, fahre ich zunächst ein paar Runden, nicht am Limit, aber flott. Da ist natürlich noch nichts perfekt abgestimmt, deshalb sammle ich Informationen. Die gebe ich beim Boxenstopp grob durch, dann werden die Einstellungen schrittweise verfeinert – so ist die Herangehensweise. Die Elektroniker können meine Aussagen natürlich mit den aufgezeichneten Daten abgleichen. In welcher Kurve es rutscht oder wo ich ein anderes Problem habe, muss ich mir auf dem Weg zur Box aber schon merken können ...
? Theoretisch kann die Motorsteuerung auch während eines kurzen Boxenstopps komplett verändert werden. Kommt es vor, dass du nach dem Stopp mit einem Motorrad weiterfährst, das einen komplett anderen Charakter hat als vorher?
! Das würde wenig Sinn machen. Wir machen eher kleine Veränderungen, die schon spürbar, aber eher in den Datenaufzeichnungen sichtbar sind. Wir können uns ja auch nicht nur um die Motorsteuerung kümmern, sondern müssen auch das Fahrwerks-Setup und die Reifen beobachten. Außerdem: Wenn mich ein Techniker mit der Ansage auf die Strecke schicken würde: „Das Mapping kann ein bisschen aggressiv sein“, würde ich dem sagen: „Dann probier‘ das mal schön selber aus.“ So etwas geht nicht im GP-Training, sondern nur bei Testfahrten.
? Dir wird viel Vertrauen in die Technik abverlangt, aber du bist 2015 gestürzt, weil ein Sensor kaputtgegangen ist, deshalb die Traktionskontrolle ausfiel und du keine Warnung bekommen hast. Wie geht ein Fahrer mit solchen Erlebnissen um?
! Ich hatte zwei Defekte, einer endete mit einem Sturz. Da war ich schon recht sauer. So etwas sollte nicht passieren, aber es kommt schon mal vor, dass es einen Defekt gibt oder mit einem neuen Mapping ein Fehler eingespielt wird. Dafür sind dann die Auslaufzonen da.
? Kannst du am Kurvenausgang einfach Vollgas geben, und die Traktionskontrolle sorgt dann dafür, dass nicht mehr Leistung am Hinterrad ankommt, als für eine sichere Fahrt gut ist?
! Aus der Kurve rausfahren und einfach Vollgas geben? Ich kenne niemanden, der das macht. Wir haben so viel Leistung, da braucht es schon etwas Respekt. Ich mache das noch genauso wie zu meinen Zweitaktzeiten – aus der Kurve raus sanft das Gas aufziehen. Die Traktionskontrolle regelt, aber je mehr sie regelt, umso langsamer fahre ich.
Es geht nichts über ein gutes Gefühl für das Hinterrad im Handgelenk. Je mehr ich die Traktionskontrolle machen lasse, desto schwieriger wird es auch mit dem Reifenverschleiß. Ich muss die richtige Kombination zwischen Traktionskontrolle und dem von mir selbst gesteuerten Sliden und Durchdrehen des Hinterrads finden.
? Wie hört sich denn eine typische Unterhaltung zwischen Fahrer und Technikern bei einem Boxenstopp an?
! Das ist wie ein Frage-und-Antwort-Spiel. Es kommt auch vor, dass ich sagen muss: „Leute, tut mir leid, ich spüre keine Veränderung.“ Das Wichtigste ist, in der Situation als Fahrer ehrlich zu sein.