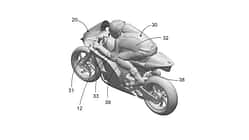Motorrad-Rennsport ist anders als die meisten Sportarten. Komplexe Technik spielt eine große Rolle. Und wenn sich die Maschinen ändern, ändern sich auch die Fahrer. Darum dreht es sich bei der Entwicklung der unterschiedlichsten Fahrstile im GP: Während die Motorräder besser werden, lernen die Fahrer neue Dinge oder bedienen sich sogar alter Tricks, um einen Vorteil zu haben. Und ab und zu gibt es diesen besonderen Fahrer, der das Spiel mit seiner Genialität neu ordnet.
Der Job eines Renntechnikers ist dagegen ziemlich geradlinig: Er baut ein Motorrad, das in Kurven und Geraden so schnell wie möglich fährt. Die Ingenieure nehmen sich nicht vor, einen biestigen Motor zu entwickeln oder ein Chassis zu bauen, das agil ist wie ein Öltanker. Aber das passiert. Normalerweise, weil es sich nicht vermeiden lässt. Alles, was die Fahrer tun können, ist, das Beste aus dem zu machen, was man ihnen in die Hand drückt. Während der folgenden Jahre wird dann weiterentwickelt, und Probleme werden gelöst. Es gibt neue Reifensorten, andere Bremsanlagen oder Rahmen, revolutionäre Kunststoffe und andere Zündfolgen. Die Motoren drehen höher, aber werden kontrollierbarer, die Chassis steifer, und die Reifen haben mehr Grip.
Fahrer, die mehr leisten, als sich mit dem zufriedenzugeben, was vorhanden ist, verändern die Spielregeln zusätzlich. Und werden deshalb zu Legenden, wie Mike Hailwood, Kenny Roberts, Wayne Rainey, Mick Doohan und Valentino Rossi. All diese Jungs haben das Limit auf ein neues Niveau gehoben.
Die Ironie: Heute sind wir da, wo wir schon einmal waren. Während der 1960er-Jahre fuhren die Racer präzise -Bögen durch die Kurven. Dann verwandelte sich die ballettartige U-Linie in ein böses V. Heute sind wir mit elektronisch kontrollierten 800er-Bikes wieder beim U angekommen. Der einzige Unterschied: Die brutale Geschwindigkeit, die atembe-raubende Schräglage und die schleifenden Ellbogen. Wie lange wird das so sein? Die Geschichte lehrt uns: mit immer neuer Technologie und Typen wie Stoner wahrscheinlich nicht mehr lange.
1960er & 1970er

Technik:
Scheibenbremsen, Alu-Felgen, breite Reifen
Fahrer:
Mike Hailwood, Giacomo Agostini
Vor einem halben Jahrhundert fuhren Rennfahrer so konventionell wie der normale Straßenfahrer heute noch. Kein Hanging-off und Knie-raus. Natürlich fuhren sie so schnell es die Technik ihrer Zeit zuließ. Aber die alten GP-Kisten der 60er hatten grauenhafte Bremsen, wenig Grip und eine vergleichsweise maue Leistung, weshalb es die Helden von damals in den Kurven einfach laufen ließen und sich darauf konzentrierten, Schwung mitzunehmen. „Es ging darum, den Speed möglichst zu halten, denn du hattest nicht wirklich eine Bremse und Beschleunigung“, erzählt der dreifache GP-Sieger Mick Grant. In der Zeit von weichen Rahmen und dünnen Reifchen fuhren die Jungs deshalb unspektakuläre Linien. „Damals hast du beim Anfahren der Kurve die Bremse gezogen, sie auf dem Weg zum Scheitel langsam rausgelassen und langsam ab da wieder Gas gegeben. Der Bogen bis zum Scheitel war identisch mit dem raus“, erzählt Peter Williams, der 1967 als Vierter die 500er-WM beendete. „Nicht so wie heute, wo sie das Bike schnell aufrichten und dann das Gas voll aufdrehen.“
Zwar hatten ein paar Burschen die überlegene MV Agusta, aber alle fuhren auf den gleichen Reifen. „Es gab nur die Dunlop Triangular“, weiß Williams. „Also hatte jeder denselben Stil. Wir versuchten, ganz rund zu fahren.“ Und das blieb lange so. Die 60er-Legende Giacomo Agostini erinnert sich, seinen Fahrstil erst kurz vor seinem Karriere-Ende in den 70ern umgestellt zu haben. „Die Motorräder änderten sich ja kaum, also gab es auch keinen Grund für große Veränderungen“, sagt der 15-malige Weltmeister. Hanging-off und Gewichtsverlagerung waren nicht nur unnötig, sondern glatt kontra-produktiv. „Wenn du nur 49 PS hast, brauchst du beim Gasgeben kein Gewicht aufs Vorderrad zu bringen“, lacht Grant. „Beim Bremsen war es das Gleiche. Hinten wurde nichts leicht.“ Der runde Fahrstil war also gefragt, auch weil die Rahmen sehr dünn und die Federwege gleich null waren, und die Maschinen auf Unruhe etwa durch herumhampelnde Fahrer nicht gut reagiert hätten.
Zweifellos kümmerten sich die Ingenieure damals mehr um andere Dinge als das Chassis-Design. Anfang der 60er hatte ein Honda 125-GP-Twin eine Liter-leistung von 184 PS. Am Ende der Dekade leistete die Zweitakt-Yamaha V4-125er 340 PS pro Liter. Da blieb nicht viel Zeit fürs Chassis. Für die Ingenieure war Leistung alles - ganz besonders in Japan. „Das war das große japanische Problem“, erinnert sich Ago, der auf MV 1966 und 1967 Mike Hailwood auf Honda den 500er-Titel wegschnappte. „Als ich mit Mike um den Titel fuhr, hatte die Honda mächtig Power, aber das Fahrwerk war katastrophal.“ Das unterstreicht Mike Hailwoods knapper Kommentar, als ihn die Honda-Techniker nach dem Handling der legendären Sechszylinder-250er fragten: „Einfach grauenhaft!“
Aber als die Reifen- und Chassis-Entwicklung dann doch einsetzte, änderte sich der Fahrstil auch. Ende der 60er streckten die ersten Fahrer ihr Knie raus, auch wenn die Gründe dafür andere -waren als heute. „Wegen dem besseren Grip schliffen wir langsam mit den Stiefelspitzen über die Straße“, erinnert sich Williams. „Hailwood fuhr am schrägsten und schliff seine Stiefel so weit durch, bis die Zehen bluteten. Um das zu vermeiden, zogen wir die Zehen bis innen auf die Rasten zurück, wodurch das Knie nach außen gedreht wurde.“ Williams kam auch schnell in den Genuss weiterer Neuerungen wie die ersten Scheibenbremsen, dann Alu-Felgen, was den Fahrern erlaubte, Dinge zu tun, die vorher unmöglich waren. „Die Scheibenbremsen hielten das Rad viel besser auf Kurs als Trommelbremsen, wodurch man effektiver in die Kurven hineinbremsen konnte“, sagt Williams. „Bei den leichten, schlauchlosen Alu-Felgen gab es weniger gyroskopische Kräfte, und die Bikes ließen sich sehr viel einfacher einlenken. Außerdem reagierte die Front nicht so wild auf irgendwelche Bodenwellen, weshalb man in den Kurven schneller war.“
Als in den frühen 70ern schließlich rundere und breitere Reifen kamen, nahm nicht nur der Speed zu, sondern sie hatten auch einen radikalen Einfluss auf die Fahrtechnik. Selbst Ago musste sich der Knie-raus-Generation anpassen. „Ich nahm das Knie raus, weil sich die Motorräder auf den breiten Reifen schlechter einlenken ließen, plötzlich musste man mit dem Körper nachhelfen.“
1970er & 1980er

Technik:
Slicks, Radial-Reifen, Drehschieber- und Membran-Steuerung, lange Federwege
Fahrer:
Kenny Roberts, Freddie Spencer
Als die großen Zweitakter kamen, änderte sich alles. Ab Anfang der 70er schoss die Leistung der Bikes derart in die Höhe, dass die Reifen- und Chassis-Ingenieure völlig überrumpelt wurden. Es würde nun einige Jahre dauern, bis sie die Sache in den Griff bekamen, und so mussten die Fahrer bis dahin selbst auf sich aufpassen. Die 500er und 750er gaben ihre brutale Leistung so hinterhältig ab, dass das Motorrad an sich eigentlich völlig überfordert war. Zu Beginn taten die Fahrer ihr Bestmögliches und wandten ihren gelernten Stil der „zahnlosen“ Viertakter an. Dann tauchten die Amerikaner auf, die ihr Fahrkönnen auf Dirt Track-Ovalen gelernt hatten, aber bis Anfang der 70er von Straßenrennen wenig verstanden. „Bei uns gab es eigentlich keine -echten Straßenrennen“, erzählt Kenny Roberts. „Nur eine Handvoll Typen waren überhaupt konkurrenzfähig beim Dirt Track und den Straßenrennen. Als ich anfing, fuhr ich wie jeder andere bei uns auch, aufrecht rauf und runter.“ Das fühlte sich für den künftigen King aber nicht gut an, und als das GP-Genie Jarno Saarinen 1973 in den USA auftauchte, sah Roberts genau hin. „Ich sah ihm zu und fragte mich, warum der sich so raushängt. Dann hab ich es auch probiert und fühlte mich gleich viel besser.“
Indem sie ihr Gewicht nach innen verlagerten, schafften es die Fahrer, die schwerfälligen Motorräder viel besser einzulenken. Das „Hinaushängen“ verringerte außerdem die Schräglage und ließ so mehr Kurvenspeed zu. Eigentlich war das der Anfang der Fahrtricks, mit denen Fahrer sich Vorteile verschafften und auf technische Mängel reagierten.
Roberts setzte deshalb als Nächstes seine Dirt Track-Technik auf Asphalt ein und opferte den Speed kurveneingangs für höhere Geschwindigkeit am Kurvenausgang. „Ich erinnere mich, wie ich den mehrfachen Daytona-Sieger Dick Mann überrundete. Vor einer Kurve schloss ich zu ihm auf und hab mich ganz schön erschreckt, wie schnell der Typ da reingefahren ist. Aber am Kurvenausgang wäre ich dann fast in ihn reingeknallt, denn er fuhr immer noch so schräg, dass er kaum Gas geben konnte.“
Der Speed aus einer Kurve heraus ist fast immer wichtiger als hinein, denn den Schwung kann man prima auf die nächste Gerade mitnehmen. Deshalb entwickelte sich Roberts’ Stil zum Nonplusultra, auch weil er so um die Probleme beim Chassis und den Reifen „herumfuhr“. „Damals gab es nur eine effektive Methode, ein Motorrad schnell durch die Kurve zu fahren: langsam am Scheitel, aufrichten, ausrichten, Gas geben.“ Dieser Stil brachte weitere Vorteile. Roberts’ rücksichtslose Art, Gas zu geben, sorgte für ein durchdrehendes Hinterrad, so dass das Motorrad am Kurvenausgang hinten rutschte und sich noch schneller ausrichtete.
Um das Bike bis zum Scheitel runterzubremsen, rutschte der Amerikaner sogar übers Vorderrad - wie er das beim Dirt Track gemacht hatte. „Es hat richtig über vorn geschoben, und ich hab für mehr Reibung sogar das Rad noch leicht eingelenkt. Das hat super funktioniert, denn wenn es wegzurutschen drohte, war dein Knie ja schon am Boden, um es zu retten.“ Statt dem Dirt Track-Stahlschuh wurde das Knie wie zu einem Drehpunkt. „Durch das Hanging-off und das schleifende Knie fühlte ich genau das Bike driften.“
So machte Roberts aus dem klassischen U so etwas wie ein radikales V. Plötzlich fuhren alle talentierten Racer solche spektakulären Linien, die sie jetzt um Welten von normalen Straßenfahrern unterschieden. Und so ist das bis heute geblieben.
Die Weiterentwicklung der Motorräder blieb allerdings auch nicht stehen, denn die Hersteller entdeckten die Bedeutung von Chassis und Reifen. „In den 60ern ging es doch nur darum, wie viel Zylinder sie an so ein Ding schrauben konnten“, lacht Roberts. „Als ich dann fuhr, wechselten sie von Reihen- zu V-Motoren, sie kümmerten sich plötzlich um Rahmen, Dämpfer, Gabel und Bremsen, und die Reifen wurden besser. Wir brachten schließlich als Erste die Good-year-Slicks, und bald darauf hatten alle profillose Reifen.“
Der irren Zweitakt-Leistungsabgabe Herr zu werden, war eine zentrale Auf-gabe. Drehschieber-Technik war Standard, bis Freddie Spencer 1983 mit der Honda NS 500 mit Membransteuerung Roberts den Titel abjagte. Schon bald hatte jeder die Membran-Lösung.
Die NS war nicht wie die anderen 500er. Sie war flink und freundlich und erlaubte Spencer etwas, das die anderen vorher nicht kannten: „Wenn ich vorn zu viel Gewicht hatte, gab ich Gas und verlagerte es damit nach hinten, bis es rutschte. So hab ich mich dazwischen hin und her gehangelt.“
Die Membran war nur eine Entwicklung hin zur besseren Kontrolle der Leistungsabgabe, die es den Fahrern möglich machte, das Limit mit weniger Risiko noch weiter zu verschieben. Gleichzeitig wurden die Rahmen steifer und die Federwege länger. „Die ersten TZ bockten so brutal, dass man sie niederringen musste“, erinnert sich Roberts. „Es gab Jungs, die sie sauber fuhren, aber die waren langsam. Die Jungs mit den sich wild schüttelnden Dingern gewannen die Rennen. Ich fuhr die TZ mit steilerem Lenkkopfwinkel, damit sie schneller einlenkte. Dafür wackelte das Ding wie ein Kuhschwanz. Mein Tuner Kel Carruthers bohrte daraufhin die Lenkungsdämpfer auf und goss Getriebeöl rein. Im Fahrerlager ließ sich der Lenker gar nicht mehr einschlagen, aber das war die einzige Chance, um das Motorrad in den Griff zu bekommen. Als Yamaha längere Dämpfer brachte, wurde alles geschmeidiger und wir konnten die Lenkungsdämpfer abbauen. Die steiferen Rahmen erlaubten eine härtere Fahrweise über längere Zeit. Denn wenn sich alles verwindet, -alles rutscht und schaukelt, dann setzt dir deine Physis die Grenzen.“ Der nächste große Sprung waren Radialreifen. „Die Radialreifen hatten viel mehr Grip und waren deutlich stabiler. Damit konnte man irre früh Gas geben“, meint Spencer.
1980er & 1990er

Technik:
Upside-down-Gabeln, Carbon-Bremsen, Big Bang-Zündung
Fahrer:
Wayne Rainey, Mick Doohan
Die technischen Verbesserungen machten es den amerikanischen und australischen Invasoren möglich, Roberts’ oft unkontrollierte Slides zu einer wahren Kunstform zu erheben. Die Künstler waren Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Wayne Gardner, Mick Doohan und ein paar andere. Aber eigentlich waren die Bikes noch gar nicht so weit. Doohans NSR 500 von 1989 war ein grausames Monster. „Du konntest das Bike runterdrücken, aber es wollte einfach nicht abbiegen, nur stur geradeaus fahren. Also musste man ganz schön früh einlenken, um den Scheitel überhaupt zu treffen“, erinnert sich Doohan. „Der Motor war auch ein Biest. Man musste seitwärts aus der Kurve, um überhaupt auf der Strecke zu bleiben. Das durchdrehende Hinterrad fühlte sich auch sicherer an, als den Reifen auf der Kante zu fahren und nicht zu wissen, wann er wegschmiert.“
Aber die Entwicklung ging weiter, und dank besserer Chassis und Reifen war Kurvenspeed wieder wichtig. Jetzt galt: schnell rein, schnell raus. „Einige Leute meinten, ich würde zu schnell in die Kurven reinfahren, aber ich wollte so schnell es geht da durch“, erzählt Doohan. „Ich habe so lange gemotzt, bis ich die passenden Vorder-reifen bekam. Als die Hinterreifen besser wurden, war es am schnellsten, in einer sauberen Linie durchzufahren. Am Ende ist quer nicht schneller. Ein bisschen Übersteuern hilft, wenn die Piste ausgeht, aber für mich ist die Hinterrad-Bremse immer noch die beste Methode, Untersteuern zu verhindern.“
Die besseren Vorderreifen machten nicht nur die Dirt Track-erfahrenen Jungs schneller. Sie erlaubten es auch Europäern wie Luca Cadalora und Alex Crivillé , die ihr Handwerk mit 125ern auf der Straße gelernt hatten, ganz vorn bei den 500ern mitzufahren. Diese Jungs machten aus dem V wieder ein U. „Als Luca 1993 mein Team-Partner war, fuhr er gewaltig schnell in den Kurven“, sagt Wayne Rainey. „Er hatte einen ganz anderen Stil als ich, er war Mr. Kurvenspeed. 1988 hätte er damit keine Chance gehabt, nicht mit den Reifen damals.“ Die Dirt Track-Fraktion behielt dennoch die Oberhand, denn ihr Stil funktionierte auch noch, wenn die Reifen nachließen.
Neben den Reifen gab es noch einen weiteren Grund für den hohen Kurvenspeed. Dazu Wayne Rainey: „Als ich die erste Öhlins-Upside-down-Gabel fuhr, war die so viel steifer, dass man einen direkten Draht zum Vorderreifen hatte. Hast du die Stummel bewegt, war das matschige Gefühl einfach weg, und man konnte alles etwas später machen, bremsen und einlenken etwa. Carbon-Bremsen waren auch etwas, das alles schneller machte. Das Motorrad war flinker, und man musste nicht mehr so brutal daran herumzerren.“
Die Bremsen und Gabeln waren ein großer Schritt, hätten aber ohne passendes Chassis nicht so gut funktioniert. Zum Glück erkannten die Werke die Bedeutung von Steifigkeit. „Als sie dem auf die Schliche kamen, konnte man Kurven sehr schnell fahren, denn das Bike hat es vertragen“, so Rainey. „Wenn ich mir Videos von damals anschaue, seh ich, wie sich meine Haltung komplett verändert hat, meine Beine, die Beugung meines Rückens, wie ich meine Ellbogen ausrichte und wo meine Hände sind. Von meinem ersten Jahr 1988 bis 1993 sind da zwei total verschiedene Fahrer am Werk.“
Raineys Hauptaugenmerk lag auf einer sanften Leistungsabgabe da, wo er am Kurvenausgang Gas gab. Das war der entscheidende Moment. Wenn das klappt, gibt es ein paar Meter Vorsprung. Geht es schief, fliegt man ein paar Meter durch die Luft. „Auf der 500er lief es darauf hinaus, am Kurvenausgang alles hinzubekommen“, sagt der dreimalige Weltmeister. „Wenn du eingebogen bist und das Gewicht auf dem Vorderrad lag, lag dein Leben in der Hand des Motorrads, bis du das Gas wieder aufgemacht hast. Ich wünschte mir einen Motor, der ganz fein ansprach und sanft das Gewicht vom Vorderrad nahm. Ab da war ich wieder Chef im Ring. Dann kam es nur noch darauf an, wie weit du es aus der Kurve herausbekommst, bis es hinten rutschte. Ein leichter Rutscher war alles, was du brauchtest, um sauber aus der Kurve zu kommen. Wenn es dann wegen zu viel Grip nicht rutschte, hast du einfach nochmal nachgedrückt. Das war aber auch gefährlich, weil die Flanke unter Spannung stand und sich auch mal plötzlich entspannte und richtig zurückschnellte.“ Es gibt beeindruckende Aufnahmen von solchen Highsidern!
1992 machte Hondas Big Bang-Zündung schließlich die Sache etwas sanfter - besonders für die Europäer. Als 1998 der bleifreie Sprit kam, wurde es noch etwas zahmer, und die Fahrer konnten schon in tiefer Schräglage die Hähne spannen. „Bleifrei machte die 500er zu 250ern“, erinnert sich Doohan. „Ich musste mir richtig antrainieren, das Gas schon in Schräglage aufzureißen. Noch ein Jahr zuvor wärst du garantiert im hohen Bogen abgeworfen worden.“
Stück für Stück wurde aus der 500er ein normales Rennmotorrad, mit dem auch einigermaßen normale Fahrer gut umgehen konnten. Aber wie immer: Die ganz cleveren Fahrer fanden Mittel und Wege, den Unterschied zu machen. -Rainey etwa nutzte die Vorderrad-Bremse, um schnell durch enge Schikanen zu kommen. Hin zum Punkt genau zwischen den Kurven bremste er vorn stark, wodurch sich das Bike urplötzlich aufrichtete. (Bitte nicht nachmachen!) Garry McCoys Methode war sogar noch wilder: „Ich hab mitten in der Schikane einen Fast-Highsider provoziert, damit mich das Bike wie von selbst auf die andere Seite warf.“ (Bitte erst recht nicht nachmachen!)
Das 21. Jahrhundert

Technik:
Viertakter, Traktionskontrolle, Bridgestone-Slicks
Fahrer:
Valentino Rossi, Casey Stoner
Die 500er waren bald recht manierliche Maschinen, aber ihre Zeit war um. Es gab so gut wie keine zivilen Zweitakter mehr, und so musste sich der Grand Prix anpassen. Der Umstieg auf die MotoGP-Bikes war ein krasser Schnitt. Jahre der 500er-Chassis-Erfahrung stießen auf große, freundliche 990er-Motoren. Der Fahrstil änderte sich gleich mit, aber der größte Sprung kam erst noch. Mit den 990ern kam das wilde V wieder ins Spiel, weil sie schlicht so stark waren - 230 PS gegenüber den 190 PS der 500er. „Wenn du so viel Power hast, musst du dich so viel wie möglich auf die Beschleunigung konzentrieren. Über den Kurvenspeed musst du dagegen nicht wirklich nachdenken“, sagt Valentino Rossi, der letzte 500er und erste MotoGP-Champion. „Die 990er richtet man so früh es geht auf und stellt sie auf den fettesten Teil des Reifens“, analysiert Colin Edwards. „Bei den Dingern ging es nur darum, die Geraden länger zu machen, als sie eigentlich waren.“
Mit den 800ern war das wieder schlagartig vorbei. Sie hatten weniger Drehmoment, eine viel bessere Elektronik und ganz neue Reifen. „Mit der 990er hast du einen Fehler wieder ausgebügelt. Wenn du weit gehen musstest, hattest du immer noch genug Schwung, dass man es an der Rundenzeit gar nicht gemerkt hat“, erklärt Edwards. „Mit der 800er bist du einen halben Meter neben der Ideallinie - und das war es dann.“
Die 800er - und die Bridgestone-Reifen - sind viel kniffliger, weil sie sehr viel mehr Kurvenspeed zulassen, was millimetergenaues Fahren nötig macht. Und so mutierten die Linien erneut vom V zurück zum U. Nicht ganz die eleganten Bögen der 1960er, aber furchtbar schnelle, mit viel Druck gefahrene Kurven - höchst gewalttätig: bremsen wie ein Wahnsinniger, Bein hängen lassen für einen besseren Hebel und Balance, Bremse voll rauslassen und das Bike mit brutalem Speed sofort in die Kurve werfen. Und auf keinen Fall hinten mitbremsen - deshalb tun sich Superbike-Fahrer auf den 800ern so schwer.
„Der Michelin-Stil war: volles Rohr am Kurvenausgang - fertig“, sagt Rossi. „Die Bridgestones haben so viel Flankengrip, dass du richtig viel Kurvenspeed fahren kannst, ohne Beschleunigung einzubüßen. Außerdem hat die Elektronik alles verändert, denn vorher musstest du dich um die Slides und Wheelies kümmern. Jetzt brauchst du halt einen guten Elektronik-Mann.“
Es ist eine weit verbreitete Annahme, dass die Elektronik den MotoGP zu einfach gemacht hat. Edwards Aussage unterstreicht das sogar: „Heute bist du in maximaler Schräglage und reißt das Gas auf. Da wackelt es hinten ein wenig. Die Elektronik passt so gut auf dich auf, dass die leichten Bewegungen sogar 10 bis 15 Grad der Kurve in einem Meter erledigen. Hast du das früher versucht, warst du auf der Reise zum Mond.“
Die Traktionskontrolle erlaubt es tatsächlich den guten Fahrern, besser zu werden. Aber wenn die Elektronik den Langsameren hilft, finden die richtig schnellen Jungs den Unterschied woanders. Denn machen MotoGP-Fahrer heute bei großer Schräglage das Gas auf, stoßen sie auf neue Probleme: Das Heck wird instabil, so dass es schwer wird, die richtige Linie zu treffen. Die Hinterradbremse mitzubenutzen, wenn Gas gegeben wird, ist nicht gerade intuitiv - aber es funktioniert. Dabei wird das Heck an den Boden gepresst, der Reifen beißt sich in den Asphalt, und die Auflagefläche wird breiter.
Aber es gibt noch ein schlimmeres Problem beim frühen Gasgeben. Im Scheitelpunkt die Drosselklappen zu öffnen, bedeutet plötzlich weniger Druck und damit Grip am Vorderrad. Wenn es nicht wegrutscht, macht es zumindest präzises Lenken schwierig und sorgt für Running-Wide, das Motorrad strebt nach außen. Die meisten Fahrer kämpfen genau damit, lassen deshalb die Finger vom Gaszug und opfern Beschleunigung für Lenken. Die Genies aber haben dafür eine Lösung gefunden. Während sie früh Gas geben, legen sie leicht die Vorderrad-Bremse an, halten so den Druck am Vorderrad aufrecht, schaffen Grip und können steuern. Ein riskantes, aber effektives Manöver.
„Es hängt von der Kurve ab“, meint Casey Stoner. „Wenn das Motorrad gut abgestimmt ist, braucht man das meist nicht. Hin und wieder aber ist es unumgänglich.“ Jetzt, wo der Weltmeister nicht mehr auf der problematischen Ducati sitzt, spielt er mit der Honda und macht darauf etwas, was die anderen nicht machen: „Viele Fahrer bauen auf den Kurvenspeed, aber ich mag es lieber, das Motorrad aufzurichten und sehr hart zu beschleunigen. Deshalb benutze ich viel weniger Traktionskontrolle als die anderen.“
Während also Stoner die Kurvenlinie ändert, sie von einem U mal wieder in ein V verwandelt, können wir sicher sein, dass die anderen es bald nachmachen - auf den 1000ern wohl sowieso. Aber heute ist das nicht so einfach, denn der Fahrstil ändert sich nicht mit jedem Jahr, mit jedem Wochenende, sondern ein paar Mal pro Runde - hoher Kurvenspeed da, mit Slides raus dort. „Du kannst die Rennstrecke doch nicht einfach so fahren, wie du es gewohnt bist, du musst sie so fahren, wie sie es erfordert“, sagt Stoner. Der Australier wird auch mit dem Wechsel auf die 1000er klar kommen, von denen er glaubt, dass die V-Variante noch stärker wird. „Ich glaube, dass die 1000er den Stil ganz erheblich verändern werden. Schnell durch die Kurven zu kommen, wird immer noch wichtig sein, aber wir werden uns wieder ganz erheblich mehr auf den Kurvenausgang konzentrieren müssen.“ Wir werden es bald erleben und machen das V für Victory oder Vorfreude.