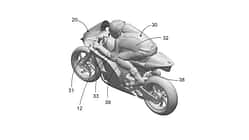Das Allerheiligste steht auf einem einfachen Tisch an der fensterlosen Stirnseite des Trucks. Davor sitzt ein Ingenieur und blickt konzentriert auf den hoch auflösenden Bildschirm an der Wand, auf dem sich immer neue Strukturen zeigen. Millimeter für Millimeter schiebt der Japaner ein Stück Reifenlauffläche unter der Optik des Elektronenmikroskops hindurch.
Die Bilder auf dem Monitor erinnern mal an Ultraschall, dann wieder an wirre Tintenkleckse. Für Laien sind sie bedeutungslos, für die Konkurrenz wären sie von unschätzbarem Wert. Aus diesen Strukturen ließen sich nämlich genaue Rückschlüsse über Aufbau und Funktionsweise der Bridgestone-MotoGP-Slicks ziehen. Die Makroaufnahmen sind deshalb streng geheim und bleiben sorgfältig unter Verschluss, ebenso wie die dünnen, etwas mehr als fingerlangen Laufflächenproben. Harmlos sehen sie aus, ein bisschen so, als hätte jemand schwarzen Spargel geschält. In Wirklichkeit sind auch diese Gummifäden hochbrisant. Sie zu analysieren, die Zutaten herauszufinden und dann einen solchen Reifen nachzubauen wäre ein Kinderspiel für andere Reifenhersteller und für Bridgestone damit ein jahrelanger und verdammt teurer Entwicklungsvorsprung dahin.
Unfassbarer Schräglagenwinkel, zähes Durchhaltevermögen
Sämtliche Reifenproben werden deshalb sorgfältig nummeriert und gesammelt. Nicht auszudenken, wenn ein, zwei dieser dünnen Streifen abhanden kämen. Ganz zu schweigen von kompletten Reifen. Doch selbst so etwas ist schon passiert, als vor ein paar Jahren ein beträchtlicher Teil der Fracht für Phillip Island plötzlich nicht mehr auffindbar war. Wo Thomas Scholz, der deutsche Einsatzleiter des Bridgestone-MotoGP-Engagements, auch suchen ließ, in Frachtcontainern, auf Speditionsparkplätzen, in Flugzeughangars, die Reifen schienen sich in Luft aufgelöst zu haben. Erst Wochen später tauchten sie wieder auf, in einem offensichtlich selten genutzten Frachtabteil unter der Pilotenkanzel der Frachtmaschine. In der Zwischenzeit hatten sie mehrere Weltreisen hinter sich. „Die suizidgefährdeten japanischen Manager konnten aufatmen“, lacht Scholz, der als langjähriger Mitreisender des MotoGP-Trosses etliche solche Anekdoten erzählen kann.
Dass penibel auf Geheimhaltung geachtet wird, liegt nicht nur am unfassbaren Schräglagenwinkel, den die Fahrer mit dem Slick erreichen. Die knapp 60 Grad, mit denen die MotoGP-Asse um die Ecken feilen, erreichen auch die Dunlop-Fahrer der Moto2 und Moto3 oder die Superbiker auf ihren Pirellis. Entscheidend ist, welchen Dreh am Gasgriff, wie viel Vortrieb die Bridgestone-Reifen selbst bei maximaler Schräglage ermöglichen. „Wenn du ans Limit gehst und richtig pushst, wird dir bewusst, wie extrem weit du mit diesen Reifen gehen kannst“, staunt der MotoGP-Weltmeister Marc Márquez.
Ebenso beeindruckend ist das zähe Durchhaltevermögen der Pneus, denn sowohl Márquez als auch der alte Champion Jorge Lorenzo drehten ihre schnellsten Runden nicht selten in der Schlussphase der Rennen.
Problem stabiles Temperaturfenster
Nur ein Problem ist ständig Thema: ein stabiles Temperaturfenster. Eine der schwierigsten Strecken in dieser Hinsicht ist der Sachsenring. Dort gab es auch im Sommer 2013 heftige Temperaturschwankungen – morgens kühl und Sommersonne an den Nachmittagen. Vor allem aber gibt es dort nur drei Rechtskurven. Der Rest der Strecke besteht aus Linkskurven mit teils sehr langen Radien, in denen die Fahrer lange in voller Schräglage sind und viel Hitze in der linken Reifenflanke aufbauen. Die rechte Reifenflanke kühlt dagegen aus, was in der nächsten Rechtskurve ungemütlich werden kann. Über 30 Stürze in drei Grand Prix-Klassen in den Trainings sprechen eine eindeutige Sprache.
Als MotoGP-Exklusivausstatter musste Bridgestone reagieren und brachte asymmetrische Slicks mit zum Sachsenring, bei denen die Spreizung zwischen weicher Mischung für die rechte und der harten Mischung für die linke Flanke größer war als für jede andere Strecke im Grand Prix-Kalender. Außerdem verwendete Bridgestone eine spezielle, hitzebeständige Konstruktion, bei der die durch Walkarbeit in der Karkasse entstehende Temperatur weniger stark an die Oberfläche dringen konnte.
Fahrstabilität, Gripverhalten, Traktion, Handling
Trotz solcher Sonderlösungen fragt sich mancher Beobachter angesichts der für alle gleichen Einheitsreifen, was die Fahrer und die drei zu den jeweiligen Herstellern Yamaha, Honda, Ducati und drei für die Claiming Rule Teams abkommandierten Bridgestone-Techniker bei ihren Sitzungen in der Box eigentlich ständig zu besprechen haben. „In erster Linie geht es um die Festlegung des Wochenend-Kontingents“, erzählt Klaus Nöhles, ein weiterer der zahlreichen Deutschen im Bridgestone-MotoGP-Team, der Honda betreut. Übers Jahr bietet Bridgestone vier verschiedene Mischungen fürs Vorderrad und fünf fürs Hinterrad an und trifft für jede Rennstrecke die Vorauswahl der jeweils zwei tauglichsten Reifentypen. Am Mittwochabend werden jedem Fahrer bereits sechs Vorderreifen (drei hart, drei weich) und neun Hinterreifen (vier hart, fünf weich) zugeordnet. Am Freitagabend, nach den beiden ersten Trainings, trifft der Fahrer die Wahl von drei zusätzlichen Vorder- und zwei zusätzlichen Hinterreifen, so dass er auf maximal sieben weiche Hinterreifen kommen kann.
Nach jedem Training werden außerdem Detailkriterien abgefragt. Fahrstabilität, Gripverhalten in verschiedenen Schräglagen, Traktion beim Rausbeschleunigen oder Handling sind ständig wiederkehrende Themen. „Manchmal ist aber auch Fingerspitzengefühl und reines Abwarten gefragt, was vom Fahrer selbst an Eindrücken kommt“, erklärt Peter Baumgartner, zuständig für Yamaha. Der hoch aufgeschossene Pfälzer ist schon seit 2001 dabei und von Valentino Rossi bis Bradley Smith ein gefragter Mann, denn die Reifen-Jungs werden von den Piloten ständig wegen der Haltbarkeit, den Fahrwerksreaktionen, den richtigen Felgenbreiten oder des optimalen Reifendrucks gelöchert. Vor allem aber wollen Fahrer und Techniker wissen, was in der Nachbarbox mit den Reifen passiert. „Das sind Informationen, mit denen wir sehr diskret umgehen müssen. Vertrauen ist alles in dem Geschäft“, weiß Baumgartner.
Bekam Bridgestone das Temperaturproblem am Sachsenring in den Griff, so herrschte beim Australien-Grand Prix schon am ersten Trainingstag Alarmstufe rot. Vor der Montage in der Box mit Reifenwärmern auf 80 Grad gebracht, steigt die Laufflächentemperatur bei normalem Rennbetrieb zwar weiter an, selten aber über 130 Grad. Doch in Phillip Island wurden plötzlich bis zu 185 Grad gemessen. Selbst in der Auslaufrunde waren die Reifenflanken noch bis zu 140 Grad heiß – und die chemischen Reaktionen unterhalb der Lauffläche außer Kontrolle. Der Griff zum Mikroskop war jetzt plötzlich alles entscheidend: Der Ingenieur konnte so nach dem Aufschneiden der einzelnen Reifen am Freitagabend nachweisen, dass sich die Lauffläche mit stecknadelkopfgroßen Luftbläschen von der Karkasse zu lösen begann.
Als hätte sich ein Hai darin verbissen
Der GAU war da. In den Jahren zuvor hatte Bridgestone die Herausforderungen der schnellen Linkskurven von Phillip Island mit entsprechend harten Laufflächenmischungen unter Kontrolle gebracht. Doch auf dem neuen Belag, bei dessen Auftrag auch die Bodenwellen glatt gebügelt worden waren, kamen mehrere Faktoren auf fatale Weise zusammen. Der neue Asphalt ist extrem scharfkantig und der Belag topfeben. Hatten die alten Bodenwellen dem Hinterreifen immer wieder kurze, temperatursenkende Ruhephasen erlaubt, ging es nun ruckelfrei durch die Kurven, was den Temperaturstau in der Reifenflanke weiter beschleunigte. Außerdem schien statt dem normalerweise vorherrschenden, kühlen Vorfrühlingswetter plötzlich der Hochsommer ausgebrochen zu sein. Und dazu war in den vergangenen Monaten viel schmieriges Öl aus dem neuen Asphalt verdunstet. Grip und Aggressivität des Belags hatten deutlich zugenommen – und stiegen mit jeder Trainingsrunde, auf der zusätzlicher Gummiabrieb kleben blieb, weiter an.
Nachdem Bridgestone die weichere Mischung aus dem Verkehr gezogen hatte, zeigte aber auch die härtere Variante Stresserscheinungen. Die Techniker zauberten noch eine extraharte Notfallmischung aus dem Container. Aber auch diese letzte, ultimative Sicherheitsreserve versagte, weshalb das Rennen zweigeteilt werden musste. Dass diese jeweils zehn Runden pro Reifen das Maximum waren, zeigte der Hinterreifen des disqualifizierten Marc Márquez, der elf Runden abgespult hatte, ehe er die Maschine wechselte (siehe Foto-Show). Dessen Lauffläche sah aus, als hätte sich ein Hai darin verbissen. Eine weitere Runde hätte der Reifen wohl kaum überstanden. „Explodiert wie bei Shinya Nakano 2003 in Mugello wäre er nicht“, erläutert Baumgartner. Damals riss es den Hinterreifen des Kawasaki-Stars bei Tempo 340 buchstäblich in Stücke. Die „Crossbelt“-Konstruktionsweise des Karkassenunterbaus wurde nach diesem spektakulären Unfall damals komplett geändert. Bei der neueren Monospiral-Konstruktion sind solche Schäden so gut wie ausgeschlossen. „Die Luft wäre bei Marcs Reifen auf jeden Fall dringeblieben“, versichert Baumgartner.
Hauptbelastung der Reifen wanderte nach innen
Die Komplexität dieser Entwicklungen wird von den Fans auf den Rängen nicht wahrgenommen, ist für die Show ebenso wie die Sicherheit der Fahrer aber unerlässlich. Zwar geht die Kontur der Reifen bereits aufs Jahr 2008 zurück, dafür änderten sich aber immer wieder die Karkassenkonstruktion und die Laufflächenmischungen. 2012 wurde der Hubraum von 800 auf 1000 cm3 aufgestockt. Seither beobachtet Bridgestone, dass die Hauptbelastung der Reifen von der äußersten Flanke nach innen wanderte. Das passt zur sich ändernden Fahrweise, die sich von den langen Kurvenradien zum spitzen „aim-and-shoot“-Stil gewandelt hat, bei dem die Fahrer möglichst geradlinig auf den Kurvenscheitel zubremsen, kurz umlegen, so schnell wie möglich wieder aufrichten und das Drehmoment der gewaltigen Motoren für optimalen Schub ausnutzen.
„Überrascht hat“, so Peter Baumgartner, „dass die Reifentemperaturen bei dieser Fahrweise eher geringer sind.“ Weshalb weiche Mischungen gefragt sind. Die härteste wurde von den Fahrern sogar für unbrauchbar erklärt. Für 2014 gibt es deshalb auf Baumgartners Anregung hin einen weiteren Entwicklungsschritt. In Misano erstmals getestet und beim Saisonfinale in Valencia als gut bestätigt, bietet dieser insgesamt harte Reifen mehr Grip an den Reifenflanken. Wie das erreicht wurde, ist den Bridgestone-Technikern freilich nicht zu entlocken. Nur so viel: Es handelt sich nicht nur um eine Multicompound-Konstruktion mit einer deutlich weicheren Lauffläche auf den äußersten Flanken, sondern auch um eine zu dieser Idee passenden Konstruktionsweise.
Geheimniskrämerei ist eben ein wichtiger Teil des Geschäfts. Das trifft nicht nur Journalisten, sondern auch Fahrer. Als Marc Márquez nach dem Titelgewinn in Valencia seinen gebrauchten Hinterreifen als Souvenir mitnehmen wollte, war der japanische Bridgestone-Manager Hiroshi Yamada entsetzt. Als Kompromiss erhielt Márquez einen jener Reifen, die nur für den Transport der Rennmaschinen montiert werden und bis auf die Farbe nichts mit den aktuellen Renn-Slicks zu tun haben. „In diesen ,Traveller‘ haben wir unsere herzlichsten Glückwünsche geritzt“, lacht Thomas Scholz. Auch kommende Saison wird er wieder aufregende Dinge rund ums schwarze Gold für seinen unendlichen Fundus kurioser Grand Prix-Storys erleben – garantiert.