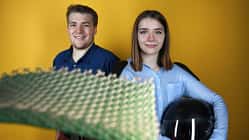Es wird keinen Sekt geben, niemand wird launige Grußworte sprechen und keiner vor dem Hauptgang einen Toast zum Besten geben. Es wird überhaupt keinen Hauptgang geben. Für wen auch? Zehn Jahre Protektoren-Norm dafür schmeißt doch niemand eine Party.
Vielleicht hängt das ein wenig mit der Stimmung zusammen, die noch zu spüren ist, wenn man nach den Ursprüngen dieser Norm fragt. Denn das Thema war Anfang der Neunziger nicht beliebt.
Motorradhersteller standen der Idee, die sogenannte »persönliche Schutzausrüstung« (PSA) des Motorradfahrers normieren zu lassen, genauso kritisch gegenüber wie die nationalen Biker-Organisationen in Europa. Man witterte einen gesetzlich verankerten Tragezwang von Protektoren-bewehrter Schutzkleidung. Und dahin wäre es mit der Freiheit auf zwei Rädern. So verständigte man sich auf ein Gentlemens Agreement: Erst wenn ein Hersteller in der Werbung oder seinem Katalog ausdrücklich auf die Schutzwirkung seiner Motorradbekleidung hinweist, muss das Produkt entsprechend zertifiziert werden. Kritikern und Zweiflern bestätigte ein offizielles Schreiben der Europäischen Kommission, dass es trotz Normierung zu keiner Tragepflicht kommen werde.
Während sich die Normen-Gegner nun gemütlich zurücklehnen konnten, hatten die Befürworter, die vor allem aus Großbritannien und den skandinavischen Ländern kamen, mehr oder minder freie Bahn. Als Ergebnis dieser Grabenkämpfe wurde schließlich am 17. November 1997 die Europäische Norm für Aufprallprotektoren, Kürzel EN 1621-1, angenommen. Das Ergebnis, so sind sich heutige Betrachter und damals Beteiligte sicher,
fußte mehr auf politischen Wirren denn technischer Praktikabilität. Generell, so urteilten Kritiker, fehlen in der Norm medizinische Aspekte genauso wie Vorgaben für den Einbau oder die Trageeigenschaften der Protektoren. Und solche Dinge, so hört man allerorten, müssten gerade in einer Norm geregelt sein, die sich mit der PSA für Motorradfahrer befasst. Umso erstaunlicher ist, dass die Norm den ersten Routinecheck, der generell alle fünf Jahre erfolgt, schadlos überstanden hat. Zu groß war anscheinend die Furcht, alte Kämpfe erneut zu entfachen.
Dennoch wollte man den nächsten Check, der turnusgemäß erst in diesem Jahr wieder an der Reihe gewesen wäre, nicht abwarten. Als klar wurde, dass in den Mitgliedsstaaten keine Forderung nach Normenrevision laut werden würde, beschloss man innerhalb des zuständigen CEN-Komitees TC 162, zuständig für »Schutzkleidung einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten«, eine Ad-hoc-Kommission mit der Revision der EN 1621-1 zu beauftragen.
Klar ist: Eine neue Version der Gelenkprotektoren-Norm wird kommen. Sie wird schärfere Grenzwerte genauso beinhalten wie neue Prüfverfahren. Gegenüber MOTORRAD betonen viele Ausschussmitglieder auf deutscher und europäischer Ebene, dass die heutige Diskussion nicht vergleichbar ist mit den Schwarzweißargumenten, die man sich vor über zehn Jahren an den Kopf geworfen hat.
Generell sei die Zusammenkunft im Ausschuss »sehr konsensorientiert« und würde »mehr im Dialog als rein fordernd« geführt. So könnten sich beispielsweise Unfallforscher und Hersteller auf einen Kompromiss einigen, der medizinisch notwendig ist, aber tatsächlich auch den ergonomischen Anforderungen beim Motorradfahren entspricht. Das Motto: Was nützt der beste Protektor, wenn er faktisch nicht tragbar ist. Vor zehn Jahren, da sind sich viele einig, wäre eine solche Diskussion undenkbar gewesen. Indes: An den Grundfesten wird nicht gerüttelt. Der Falltest und die daraus ermittelte Restkraft werden weiterhin zentraler Bestandteil der Norm sein.
Hier haken Kritiker ein: Für sie fehlen nach wie vor biologische Grundlagen in der Norm. Sie müsste auf einer ganz anderen Erkenntnis aufbauen: Was hält ein menschlicher Knochen aus, wann bricht er, wie muss der Schutz beschaffen sein, um das zu vermeiden? Überhaupt müsste in deren Augen das Prozedere des Falltests deutlich mehr Praxisnähe aufweisen indem man beispielsweise das Ansprechverhalten von Protektoren auch bei geringeren Fallhöhen testet.
Anstelle Partylaune wird also weiterhin feste diskutiert. Und vielleicht knallen ja dann die Korken zum 20. Jubiläum.
Der Unfall und die Folgen - Aua mit Ende?
Wie viel bringt ein Protektor im Unfall tatsächlich? MOTORRAD hat bei Unfallforscher Dietmar Otte nachgefragt.
Der Mensch hat Grenzen, an denen kann man auch mit modernen Protektoren nicht rütteln.« So das Fazit von Unfallexperte Dietmar Otte von der Medizinischen Hochschule Hannover. Beim stumpfen Aufprall auf ein stehendes Hindernis können sich Protektoren kaum in Szene setzen. Aber »sie können das Verletzungspotenzial absenken: Aus komplizierten Frakturen werden einfache Brüche, zudem lassen sich schmerzhafte Langzeitfolgen minimieren.« Otte über den idealen Protektor: »Optimal ist ein Plattenverbundsystem, bei dem die punktuell einwirkende Kraft auf eine große Fläche verteilt wird und ein Schaumpolster als Stoßdämpfungszone fungiert.
Europa und der Schutz der Biker - Norm gut, alles gut?
Stoßdämpfung, Schutzfläche: Was die europäische Vorschrift von Protektoren in der Motorradbekleidung fordert.
Am Stammtisch fällt schnell das Wort »Protektor«, wenn es um die Schutzpolster in Motorradbekleidung geht. Doch Vorsicht: Als Protektor gilt in der Motorradbekleidung nur das, was entsprechend der Europa-Norm EN 1621 zertifiziert ist. Europa-Normen werden vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) beschlossen, diese hier ist mit Teil 1 (Kürzel EN 1621-1) im November 1997 angenommen worden und befasst sich mit den »Anforderungen und Prüfverfahren für Aufprallprotektoren«. Die EN 1621-2 ist jünger: Gültig seit Juli 2003, werden im zweiten Teil die Anforderungen und Prüfverfahren für Rückenprotektoren beschrieben. Zentrales Element beider Teile ist der Stoßdämpfungstest: Ein Fünf-Kilo-Fallkörper stürzt aus einem Meter im freien Fall auf den Protektor, ein darunter liegender Messkopf registriert die Restkraft. Gelenkprotektoren dürfen im Durchschnitt maximal 35 Kilo-Newton (kN) durchlassen. Für Rückenprotektoren gelten schärfere Grenzwerte. Zertifiziert nach Level 1 beträgt der maximal zulässige Durchschnittswert aus fünf Aufschlägen 18 kN, für Level-2-Protektoren ist bei neun kN Schluss. Ein Problem der Norm: Die Definition der Schutzfläche. Um die Grenzwerte einzuhalten, können Hersteller die Protektoren für kleine Schutzflächen auszeichnen. Besonders bei Rückenprotektoren tauchen immer wieder Exemplare auf, die Einsneunzig-Typen passen, aber eine lächerlich kleine Schutzfläche haben .
So prüfen Sie Ihren Protektor - Original oder Fälschung?
Nicht immer ist die CE-Kennzeichnung echt. Wir zeigen, wie Sie sich vor Fälschungen schützen können.
Eigentlich steht die CE-Kennzeichnung für Communauté Européenne, die französische Abkürzung für die Europäische Gemeinschaft. Doch bisweilen sprechen Insider auch von »China-erprobt« nämlich dann, wenn es sich um offenkundig gefälschte Ware handelt. In der Motorradbekleidung tauchen immer wieder Sturzpolsterungen mit CE-Aufdruck auf, die aber niemals ein Zertifizierungsverfahren durchlaufen haben erst kürzlich geschehen beim Test von Textiljacken mit Nano-Beschichtung (MOTORRAD 19/2007). Spätestens auf einem Fallprüfstand (und erst recht beim Unfall) würden die Schaumpölsterchen jämmerlich versagen. Doch meistens machen die Fälscher schon auf dem Produkt selbst entscheidende Fehler, indem sie es nicht den Anforderungen der Norm entsprechend auszeichnen. Vorschrift ist, dass Protektoren nicht nur selbst eindeutig beschriftet sind (siehe Fotos). Ebenso gehört eine Informationsbroschüre dazu, in welcher der Protektorenhersteller mit kompletter Anschrift aufgeführt wird.
Die Zukunft im Protektorenbau - Ein harter Kompromiss?
Schärfere Grenzwerte, mehr Tests: die neue Protektoren-Norm.
Alle fünf Jahre, so sehen es die CEN-Richtlinien vor, sollen Normen einer Revision unterliegen. Im Falle der EN 1621-1 sah man bei der ersten Durchsicht im Jahr 2002 zunächst keinen Handlungsbedarf. Was, so der Vorsitzende des zuständigen Normenausschusses Christoph Meyer vom italienischen Prüfinstitut Ricotest gegenüber MOTORRAD, bei sämtlichen Experten für heftiges Stirnrunzeln sorgte. Also wurde in einem eiligen Ad-hoc-Verfahren eine Überarbeitung außerhalb des Turnus beschlossen. Noch ist unklar, was sich genau ändern soll und wann die Neufassung wirksam wird. Wie gegenüber MOTORRAD bekannt wurde, hat sich der Ausschuss bei seiner letzten Zusammenkunft im September 2007 jedoch auf Eckpunkte geeinigt, deren Annahme für eine Neufassung der Norm als ziemlich sicher gilt. Demnach wird es zusätzlich zum bisherigen Grenzwert von 35 kN Restkraft einen zweiten Level geben, der vermutlich 20 kN betragen wird. Weiterhin wird es einen neuen Falltest geben, bei dem die Prüflinge 72 Stunden hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Damit will man die Alterungsbeständigkeit der Protektoren stärker in das Testprozedere einbinden. Optional können Hersteller ihre Produkte auch bei Hitze und Kälte prüfen lassen, um sie damit für den Gebrauch bei extremen Temperaturen auszeichnen zu lassen. »Das Rad,« erklärt ein Ausschussmitglied, »wird mit dieser Norm nicht neu erfunden. Die Neufassung wird praxisbezogener sein auch wenn man weiterhin mit den Altlasten der ursprünglichen Fassung leben wird.
Protektoren richtig kaufen - Sicher aufs Bike
Gute Protektoren sind nur die halbe Miete. Sie müssen auch gut sitzen und einwandfrei in die Kombi eingesetzt werden.
Das Paradox tritt in vielen Bekleidungstests von MOTORRAD immer wieder aufs Neue auf: Textilanzüge oder Lederkombinationen sind mit erstklassigen Protektoren ausgestattet, diese aber so ungeschickt positioniert oder eingesetzt, dass sie beim Sturz
verrutschen oder sich gar wegdrehen können. Deshalb sollte schon bei einer ausführlichen Anprobe im Laden geklärt werden, ob auch die Protektoren in der Bekleidung gut sitzen. Unsere Tipps für einen sicheren Einkauf:
Protektoren dürfen nicht lose ins Innenfutter eingehängt werden, sondern müssen fest mit dem Außengewebe verbunden sein.
Gut ist, wenn sich die Protektoren individuell einstellen lassen. Als besonders effektiv haben sich Klettflächen erwiesen.
Der Anzugschnitt muss stimmen. Beim Anprobieren die typische Fahrhaltung einnehmen und am besten mit Hilfe einer zweiten Person prüfen, ob sich die Protektoren vom zu schützenden Gelenk wegdrehen lassen.
Textilkombis sind üblicherweise sehr weit zugeschnitten. Besonders wenn man im Sommer auf das Innenfutter verzichtet, ist ein stabiler Sitz der Protektoren kaum noch realisierbar. Besser ist es, auf Protektorenwesten (Foto) auszuweichen, die eng am Körper anliegend getragen werden können.
Beim Nachrüsten von Protektoren darauf achten, dass sie ohne Spiel in die vorhandenen Taschen eingesetzt werden können. Um sich vor falschen Protektoren zu schützen, unbedingt die Angaben auf dem Protektor mit der mitgelieferten Infobroschüre des Herstellers vergleichen.
Protektorentechnik transparent - Die Materialschlacht tobt
Nachgiebigkeit fordern die einen, Härte die anderen. Welches Material eignet sich am besten für den Protektorenbau?
Im Helm hat sich seit Jahrzehnten Polystyrol, meist unter dem Handelsnamen Styropor bekannt, zur Stoßdämpfung durchgesetzt. Warum also nicht den Hartschaum zum Bau von Protektoren einsetzen? Auf dem Prüfstand zeigen diese Protektoren akzeptable Werte, zudem sind sie federleicht. Allerdings bieten sie keinen echten Tragekomfort und müssen nach einem Sturz ausgetauscht werden, weil sie sich durch Krafteinwirkung dauerhaft verformen. Gleiches gilt übrigens auch für Rückenprotektoren, in die zur Stoßdämpfung Alu-Waben eingesetzt werden. Hier haben elastische Materialien einen deutlichen Vorteil, da sie sich nach einem Aufprall wieder in ihre Ursprungsform zurückstellen. Allerdings sollten sie nicht die federnde Elastizität eines Gummiballs haben. Besonders praktisch sind Protektoren aus viskoelastischem Weichschaum, die wie eine Knautschzone am Körper funktionieren. Hartschalen haben schlechte Stoßdämpfungseigenschaften, können aber eine punktuell wirkende Kraft auf eine große Fläche verteilen.
Protektoren auf dem Prüfstand - Die richtige Kurventechnik
Nicht nur der absolute Wert zählt. Beim Falltest sollte es auch auf den Weg dahin ankommen.
Klar ist: Der Wert, den ein Protektor auf dem Fall-Prüfstand erzeugt, kann nur bedingt etwas über seine Leistungsfähigkeit beim Unfall aussagen. Unsere linke Grafik zeigt anschaulich, dass auch ein Holzbrett einen Topwert erzeugt. Allerdings liegt das Prüfstandsszenario weit über dem, was der Mensch tatsächlich aushält: Die kinetische Energie beträgt beim Aufprall 50 Joule, der Gelenkprotektor darf im Schnitt maximal 35 kN Restenergie (Rückenprotektoren je nach Level neun oder 18 kN) durchlassen. Ein menschlicher Knochen, so die Medizin, bricht bei sechs bis neun KiloNewton, ist aber biegsam. Das sollte man beim Protektorenbau berücksichtigen. So betrachtet, lässt sich aus den Kraftkurven viel für die Unfallrealität herauslesen. Vor allem, wenn man die Zeit berücksichtigt. Doch das wird bislang weder getan noch für die Neufassung der Norm erwogen.