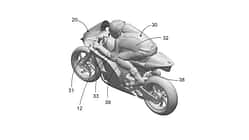Leistungssport in der höchsten Liga ist ein unbarmherziges Geschäft. Was zählt, sind Siege und die WM-Krone. Schon ein zweiter Platz trägt den Makel des ersten Verlierers. Unter solchen Umständen ist es schnell passiert, dass ein Team wie Kawasaki in die Schublade der Hinterbänkler rutscht. Dabei sind die tatsächlichen Leistungen der Mannschaft um Teamchef Harald Eckl und seiner Piloten Shinya Nakano und Alex Hofmann alles andere als drittklassig. Kenner der MotoGP-Szene zollen den Grünen nach der Saison 2004 höchste Anerkennung für den tech-
nischen Quantensprung der Ninja ZX-RR.
Entsprach die 2003er-Kawasaki noch eher einem klobigen Provisorium auf der Basis eines Superbikes der 90er Jahre, ist die aktuelle ZX-RR ein schlankes, durchdachtes Renngerät aus einem Guss. Hauptverantwortlich für die erfreuliche Wandlung ist das neue Chassis, das von der Schweizer Firma Suter Racing Technology (SRT) entworfen und gebaut wurde. So eng wie möglich schmiegt sich der Brückenrahmen um den Reihenvierzylinder und schafft genügend Raum für eine optimale Sitzposition und genügend Bewegungsfreiheit, um die 230-PS-Rakete durch gezielte Gewichtsverlagerung zu bändigen.
Mit der Airbox hinter dem Lenkkopf und dem Kohlefasertank unter dem Sitz zielte Konstrukteur Eskil Suter auf einen ideal platzierten Massenschwerpunkt für bestes Handling bei hoher Stabilität.
Bewährte Öhlins-Federelemente vorn wie hinten unterstützen diese Maßnahmen, wobei die Gabel dem MotoGP-Standard entsprechend mit einer gasdruckunterstützten Dämpfung wie bei einem Gasdruckdämpfer ausgestattet ist, um eine konstante Dämpfungsrate zu gewährleisten. Bei den gebräuchlichen Großserien-Bauteilen sind Luftpolster und Dämpferöl nicht getrennt, was zu einem Aufschäumen des Öls und dem damit verbundenen Abbau der Dämpfkraft speziell im Lowspeed-Bereich führen kann. Genau dieser Arbeitsbereich bei relativ langsamen Federbewegungen jedoch ist entscheidend für eine hohe Fahr- und Kurvenstabilität sowie eine klare Rückmeldung an den Piloten.
Beim Motor, das ist kein Geheimnis, fehlt es den Kawasaki-Piloten im Vergleich zu den klassenbesten Honda RC 211 V und Ducati Desmosedici GP4 noch an Spitzenleistung und vor allem an Durchzugskraft. Der Vierzylinder ist, vom Stirnradantrieb der beiden Nockenwellen abgesehen, eine eher konventionelle Konstruktion. Weshalb Harald Eckl mit allem Nachdruck von Kawasaki Japan neue Leistungsteile fordert. So beispielsweise für die Ventilsteuerung, die bislang mit Tassenstößeln arbeitet, während Eckl klare Vorteile bei der Verwendung von Schlepphebeln erwartet, wie sie bei Formel-1-Motoren seit Jahren Standard sind.
Im Gegensatz zum Yamaha-M1-Vier-
zylindermotor von Weltmeister Valentino Rossi zündete das Kawasaki-Triebwerk
bei den Testfahrten noch mit dem gebräuchlichen Muster, also regelmäßig alle 180 Kurbelwellengrad wegen ihres schril-
len Geräuschs werden solche Aggregate Screamer genannt. Obwohl der ehemalige GP-Fahrer und erfolgreiche Tuner Eckl vom alternativen Big-Bang-Prinzip mit asymmetrischem Zündversatz nicht überzeugt ist, laufen solche Triebwerke bereits im Versuch. Bei den letzten Tests in Jerez Ende November schien es so, als ballerten die Kawasaki bereits in einer dumpferen Tonlage, was auf die ersten Big-Bang-
Experimente schließen lässt.
Für einen Zuwachs an Drehmoment wünscht sich der Teamchef zudem variable Saugrohrlängen, wobei die Bauhöhe der Airbox Grenzen setzt. Eine sichere Bank dagegen ist die Optimierung der
inneren Reibung, die durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung aller bewegten Bauteile, von den Kolbenbolzen bis zu den Getrieberädern, einen Leistungszuwachs von rund drei PS garantiert und gleich-
zeitig die Lebensdauer erhöht.
Apropos Lebensdauer: Dieses Kapitel möchten die Kawasaki-Ingenieure so schnell als möglich vergessen, zeugten 2004 doch etliche Rauchwolken von kapitalen Motorschäden. Ursache waren laut Harald Eckl gebrochene Kolben. Ein bei MotoGP-Motorrädern eher ungewöhnlicher Defekt, da die 990-cm3-Triebwerke me-
chanische Reserven aufweisen müssten. Schließlich sind selbst die stärksten Aggregate mit rund 250 PS Literleistung noch weit von den möglichen Spitzendrehzahlen und somit der Höchstleistung entfernt. Die Maximalwerte werden einer homogenen Motorcharakteristik und fein dosierbarer Leistungsentfaltung geopfert. So wird bei Kawasaki mit unterschiedlich schweren Kurbelwellen experimentiert, um das Ansprechverhalten mehr oder weniger aggressiv zu gestalten. Bereits ein Gewichts-
unterschied der rotierenden Massen von 1,5 Kilogramm lässt die Fahrer deutliche Unterschiede in der Motorcharakteristik und beim Handling spüren.
Das erklärt auch, warum 600er-Straßensportler trotz ihres fast identischen
Gesamtgewichts wesentlich flinker agieren als 1000er. Der Hintergrund: Die Kreiselkräfte der Kurbelwelle setzen Richtungswechseln und dem Einlenken in Kurven
einen gewissen Widerstand entgegen. Gleiche Drehzahl vorausgesetzt, gestaltet sich das Handling bei Motoren mit höheren rotierenden Massen schwieriger.
Dass sich für Kawasaki dieser Aufwand auszahlt, wird schon nach wenigen Kur-
ven auf der giftgrünen ZX-RR deutlich.
Im Vergleich zum 2003er-Modell, damals noch mit Dunlop-Reifen besohlt, zischt die aktuelle Variante leichtfüßig und präzise um die Ecken. Musste der Vorgängerin
mit Nachdruck die gewünschte Linie aufgezwungen werden, findet nun Alex Hofmanns Werks-Renner den kürzesten Weg wie von selbst. Die ausgetüftelte Kontur der 16,5 Zoll kleinen Bridgestone-Slicks ist so ausgelegt, dass sich auch bei deftigen Schräglagen kein merklicher Widerstand aufbaut und sich die ZX-RR mühelos auf engstem Radius um die Kurven zirkeln lässt. Und noch eine beruhigende Eigenschaft: Die Bridgestone-bereifte Kawasaki hat das schaurige Hochgeschwindigkeitspendeln der alten ZX-RR abgelegt und bleibt selbst bei hektischen Schaltvorgängen jenseits von 230 km/h stabil.
Höchst irritierend für Nicht-Kawasaki-Werksfahrer: die elektronisch geregelte Schlupf- und Wheelie-Kontrolle. Dabei
reduziert eine Zylinderabschaltung die Motorleistung, sobald das Vorderrad beim harten Beschleunigen vom Asphalt abhebt. Dann geht das schrille Plärren des Screamers ansatzlos in wüstes Sprotzeln über, gerade so, als ob der Motor in den Begrenzer läuft. In alter Gewohnheit legt der MOTORRAD-Testpilot via Schaltautomat schnell den nächsten Gang ein
genau die falsche Reaktion. Denn eigentlich hätte der eilige Reiter das Gas einfach stehen lassen und den Motor bis in den
roten Bereich ausdrehen können. Akustisch klingt das brutale Auspuffknallen nach Zündungsschaden, rein technisch
ist es jedoch ein effizienter Trick, den
Leistungsüberschuss bis etwa Tempo 200 in den Griff zu bekommen. Aus Federweg vorn, Drehzahl, Gasstellung, Gangstufe, Geschwindigkeit und Nickwinkel der Maschine errechnet das Motormanagement die Frequenz, mit der bei den einzelnen Zylindern Zündung und Einspritzung unterbrochen wird.
Um auf die notwendige Durchzugskraft und Höchstleistung zu kommen, strebt
Teamchef Harald Eckl neue Strukturen an. Wie beim Fahrwerk erfolgreich demonst-
riert, setzt der Bayer in Zukunft verstärkt auf europäische Motorenbauteile und
Zulieferer. Kürzere Wege und innovative Technologie aus der Formel 1 sollen die Kawasaki-Motoren auf Trab bringen. Damit die steigende Tendenz der Grünen auch in der Saison 2005 anhält.
Grip ohne Grenzen
Modernste Reifentechnik macht die MotoGP-Raketen schneller und schräger.
Die brutale mechanische und thermische Belastung der MotoGP-Reifen ist für die Ingenieure der konkurrierenden Hersteller Michelin und Bridgestone eine immense Herausforderung. Zum einen wünschen sich die Piloten maximale Haftung und spielerisches Handling, zum anderen sollen die Gummis diese Qualitäten über die gesamte Renndistanz konservieren. Dazu sollte zwingend sichergestellt werden, dass sich die Pneus bei einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 347 km/h nicht in ihre Bestandteile auflösen, wie bei Shinya Nakano in Mugello geschehen. Um diesen An-
sprüchen gerecht zu werden, wurden die Felgendurchmesser auf 16,5 Zoll verkleinert, der Außendurchmesser der alten 17-Zöller jedoch beibe-
halten. Dies ermöglicht eine größere Auflagefläche
in Schräglage für mehr Grip und eine spitzere, handlichere Kontur (siehe Zeichnung). Mit der Ver-
wendung von bis zu fünf verschiedenen Gummi-
mischungen am Hinterreifen können die Reifentechniker je nach Strecke optimale Haftungs-
reserven schaffen. Beispiel Barcelona: Ganz außen rechts wird eine weiche Gummilage für extreme Schräglage (Sidegrip) aufgebracht, daneben die hoch beanspruchte und deshalb härtere Mischung für die Beschleunigungsphase (Drive) aus Kurven. Der mittige Abschnitt wird auf gute Traktion und absolute Festigkeit bei Topseed ausgelegt, um den hohen Fliehkräften und Temperaturen bis zu 140 Grad zu trotzen. Links können die Laufstreifen für Drive und Sidegrip eine Nummer weicher gewählt werden, da die Strecke nur wenige, zudem relativ langsame Linkskurven aufweist. Dieses so genannte Multi-Compound-Verfahren wird für Hin-
terreifen verwendet, bei denen extreme thermische Unterschiede von bis zu 30 Grad zwischen linker und rechter Reifenschulter auftreten. Vorn reicht bislang eine Gummimischung.
SAISONBILANZ 2004
Was Shinya Nakano und Alex Hofmann 2004 auf der Kawasaki Ninja ZX-RR geleistet haben.
Kawasakis MotoGP-Renner mit dem Reihenvierzylinder in Screa-
mer-Konfiguration machte 2004 häufig durch Motorschäden von sich reden (Foto oben). Die Statistik zeigt freilich: Im Rennen hielt das Triebwerk meist durch, wenn es der Konkurrenz von Yamaha, Honda und Ducati auch unterlegen war. Das beste Einzelergebnis: Shinya Nakano auf Platz drei in Motegi.
Technische Daten - Kawasaki Ninja ZX-RR
Motor: wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei oben liegende, über Zahnräder angetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt, Nasssumpfschmierung, elektronische Benzineinspritzung, elektronisches Motormanagement mit Schlupf- und Wheelie-Regelung, SRT-Trockenkupplung mit Anti-Hopping-System, Sechsgang-Kassettengetriebe. Leistung: zirka 235 PS bei 14500/min
Fahrwerk: Alu-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel und Schwingenlagerposition variabel, hydraulischer Lenkungsdämpfer, selbsttragendes Kohlefaser-Rahmenheck mit
integriertem 23,8-Liter-Tank, 42er-Öhlins-Upside-down-Gabel, Zweiarmschwinge aus Alu-Profilblechen, Öhlins-Federbein mit variabler Umlenkung. Doppelscheibenbremse vorn mit Karbonfiberscheiben, Ø 305 mm, radial verschraubte Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten mit innenbelüfteter Stahlscheibe, Ø 220 mm, Zweikolben-Festsattel
Maße und Gewicht: Länge 1420 mm, Sitzhöhe 850 mm, Trockengewicht 145 kg
Kontakt: www.kawasaki-eckl.com