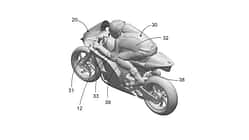Ein Blick zurück. Die Saison 2003
war gelaufen, Rossi mit der Honda-V-Fünfzylindermaschine RC 211 V Weltmeister und Yamaha am Boden. Ein einziges Mal auf dem Podium, blieb für Carlos
Checa in der Addition nur der siebte WM-Rang. Und die Erkenntnis, dass Erzrivale Honda mit dem vorhandenen Material die Dominanz im publikumsträchtigen MotoGP-Zirkus nicht zu entreißen ist.
Wie kapriziös sich die Yamaha YZR-M1, Baujahr 2003 tatsächlich anfühlte,
offenbarte sich bei den Journalisten-Testfahrten in Valencia vor einem Jahr. Sogar GP-Legende Randy Mamola wollte nach etlichen Testrunden keinen Cent mehr auf einen Yamaha-Weltmeister 2004 setzen. Auch dem MOTORRAD-Tester jagte die alte M1 Schauer über den Rücken, weil sich die elektronische Gassteuerung nicht immer vorteilhaft einmischte und das zappelige Handling jede Sekunde die maximale Konzentration erforderte. Keine Basis für einen ernsthaften Angriff auf den MotoGP-WM-Titel.
Saisonende 2004, wieder lädt Yamaha die Fachpresse zur Testfahrt auf dem
MotoGP-Bike ein. Unter anderen Voraussetzungen freilich als vor Jahresfrist: Dieses Mal ist die M1 das Fahrzeug des Weltmeisters. Der von Honda abgeworbene Superstar Rossi hat das Unvorstellbare
geschafft und die Yamaha in kaum zwölf Monaten vom Verlierer-Vehikel zur Meistermaschine weiterentwickelt.
Bei derart aufregenden Terminen kämpfen selbst langgediente Test- und Rennfahrer mit Adrenalinausschüttung in rekordverdächtigen Dosierungen. Da ist
es nur von Vorteil, dass die Yamaha gleich vom Fleck weg einen auf guten Kumpel macht. Die entspannte Sitzhaltung auf dem griffigen Sitzkissen mit perfekt
arrangiertem Körperkontakt und ein lammfrommes Chassis melden schon in der
ersten Kurve Entwarnung: keine Spur mehr von Kippeligkeit, dafür feinstes Handling mit maximaler Rückmeldung und ein traumhaftes Schräglagen-Feeling.
Erste lange Gerade, ordentlich Drehzahl und jetzt Gas. Zack, das Vorderrad vor der Nase, der Blick in den blauen
spanischen Himmel und null Plan mehr. Schnell den nächsten Gang eingeklinkt und sicherheitshalber gleich noch einen hinterher. Eine wirksame Methode, derer sich auch Meister Rossi gerne bedient, um die Urgewalten des 990-cm3-Motors in eine kontrollierbare Beschleunigung umzumünzen. Wahnsinn, wie das Ding vorwärts reißt. Unter 8000/min noch mit einer
gewissen Lässigkeit, darüber nur noch mit stramm gespanntem Bizeps. Steht die Brause offen und lässt der 240-PS-Motor bei 15200/min aufgeregt den roten Schaltblitz flackern, folgt jedem Gangwechsel ein Wheelie jedem, auch in den Sechsten.
Rossi und Konsorten drehen den Hahn etwa ab der dritten Gangstufe auf Anschlag und knacken aus dem Stand die 200-km/h-Marke nach 5,8 Sekunden (Turbo-Hayabusa mit 320 PS: 6,6 Sekunden), flitzen auf der 876 Meter langen Zielgeraden in Valencia mit über 310 km/h an der Boxenmauer entlang und bremsen, durch den orkanartigen Winddruck massiv unterstützt, die M1 mit fast 17 m/s² Verzögerung auf den letzten Drücker zusammen.
Ich mache 100 Meter früher dicht. Auf solche Gratwanderungen sollten sich lebensbejahende MotoGP-Laien nicht einlassen. Nicht nach einer, nicht nach zwei und auch nicht nach zwanzig Runden. Dafür tauchen sie mit der M1 in den lang gezogenen Kurven gierig in Schräglage und staunen nicht schlecht über diese unverrückbare Stabilität und den klebrigen Grip der Michelin-Walze auf dem Hinterrad. 190 Millimeter breit und auf der 16,50-Zoll-Felge mit einer enorm großflächigen, triangular gewölbten Lauffläche ausgestattet, erlaubt die 2004er-Reifengeneration eine sensationelle Traktion beim Beschleunigen aus den Kurven. Und genau in dieser Phase werden Rennen gewonnen oder verloren.
Mit der brachialen Leistung der MotoGP-Renner veränderte sich der Fahrstil dramatisch. Was sich daran ablesen lässt, dass die Kurvenlinie der MotoGP-Piloten regelrecht eckig und auf kürzestem Weg angelegt wird, um in möglichst geringer Schräglage, aber mit voller Leistung pechschwarze Striche auf den Asphalt zu pinseln. Die Techniker bemühen sich, Fahrwerk und Motorcharakteristik exakt auf diesen Fahrstil zu trimmen. Das heißt: optimales Handling und Lenkpräzision beim Einlenken, keinerlei Tendenz zu üppigen Kurvenradien und ein Motor, der verzögerungsfrei die Bewegung am Gasgriff eins zu eins in Schub umsetzt. Dazu ein Getriebe, das mittels hochsensiblen Schaltautomats erlaubt, die Gänge ohne den kleinsten Ruck durchzutreten.
Ein ganzes Bündel an Veränderungen machte die M1 zum Siegermotorrad. Zum einen hoben die Techniker um Jeremy Burgess, Rossis von Honda mitgebrachtem Crew-Chef, den Schwerpunkt der Yamaha um rund 20 Millimeter
an, womit Handling und Haftung
zulegten. Denn die landläufige Meinung, ein maximal niedriger Schwerpunkt wäre der beste Weg zur Handlichkeit, ist falsch.
Gut 20 Millimeter höher als die Konkurrenz kauert der Champion im Sattel, was dann von Vorteil ist, wenn sich der Spritvorrat während des Rennens vom vorderen Teil des Tanks in den tief liegenden Bereich unter der Sitzbank verlagert und sich so der Schwerpunkt deutlich absenkt. Ein zu tiefer Schwerpunkt nämlich zwingt den Piloten dazu, bei gleicher Kurvengeschwindigkeit mehr Schräglage zu fahren. Ein Umstand, der dem Hinterreifen beim 2003er-Modell in der Beschleunigungsphase enorm zusetzte, weshalb der Grip im Endspurt
dramatisch abbaute. Dagegen konnte Rossi seine Rundenzeiten beim diesjährigen WM-Finale von der zehnten bis zur
30. und letzten Runde stabil im Bereich guter 1.34er-Zeiten halten.
Für mehr Bremsstabilität bei geringen Einbußen an Handlichkeit sorgt der um
zirka 15 Millimeter verlängerte Radstand am WM-Bike, das für 2004 zudem mit neuem Rahmen und neuer Schwinge
ausgerüstet wurde. Beide Bauteile sollen durch gezielte Flexibilität für bessere Rückmeldung und eine weniger empfindliche Feder-/Dämpferabstimmung sorgen.
Der größte technische Schritt auf der Motorseite ist der Trick, den Vierventil-
Reihenmotor mit der Zündfolge eines
V-Motors auszustatten (siehe MOTORRAD 12/2004). Eine Umstellung, die zwar keine Auswirkungen auf die Leistung hat, aber die Kraftübertragung vom Reifen zu Fahrbahn schonender gestaltet und nebenbei das schrille Plärren des so genannten »Screamer«-Vierzylinders in den sonor-dumpfen »Big-Bang«-Sound verwandelt.
Immer stärker fällt bei der viel beschworenen Fahrbarkeit der MotoGP-PS-Monster die elektronische Steuerung des Motors ins Gewicht. Stichwort Traktionskontrolle: ein vom Fahrer abgekoppelter Eingriff ins elektronische Motormanagement, der verhindert, dass der Reifen
zu stark durchdreht. Was aufmerksame
Beobachter der MotoGP-Rennen daran
erkennen konnten, dass die ganz schrägen Slides mit rauchenden Gummis nur noch bei den Ducati-Piloten zu bewundern sind. Yamaha-Technik-Chef Masao Furusawa gibt sich in dieser Hinsicht etwas zugeknöpft, doch gesteht er ein, »so etwas Ähnliches« sei in der Elektronik verbaut.
Allerdings schert sich Weltmeister Rossi wenig um die elektronischen Fahrhilfen. Wenn es sein muss, kompensiert er technische Mängel mit einer geradezu genialen Feinmotorik. Anhand der Datenaufzeichnungen ist deutlich auszumachen, dass Rossi beim Wahnsinnstempo 310 bereits 20 Meter vor dem eigentlichen Bremspunkt die Vorderradbremse zieht das Gas jedoch stehen lässt und so die Frontpartie seines Motorrads um gut 20 Millimeter zusammenstaucht. Vorteil: Das schlagartige Abtauchen der Gabel über den gesamten Federweg entfällt, der Bremsvorgang wird kontrollierbarer. Zeitgleich reguliert der
Italiener die Bremswirkung des Motors beim Herunterschalten trotz der elektronischen Steuerung durch eine leicht gezogene Kupplung, die er just am Scheitelpunkt der Kurve löst, um dann sofort
ans Gas zu gehen. Perfekte Fahrtechnik, die dem gefürchteten Chattering, einem mehr oder weniger heftigen Stempeln der Räder, kaum eine Chance lässt. Genau
diese virtuosen Fähigkeiten, Maschine und Technik auch unter maximalem Stress perfekt zu dirigieren, machen Valentino Rossi zu dem, was er ist: ein Genie auf einem kaum weniger genialen Motorrad.
Technische Daten - Yamaha YZR-M1
Motor: wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit asymmetrischem Zündversatz, elektronisches Motormanagment mit Schlupfrege-lung und Regelung der Motorbremswirkung, vier Ventile pro Zylinder,
Kurbelwelle rückwärts drehend, Primärantrieb über Zwischenwelle, Anti-Hopping-Trockenkupplung, Sechsgang-Kassettengetriebe.
Fahrwerk: Alu-Brückenrahmen, Motor mittragend, Nachlauf, Radstand, Fahrzeugniveau und Schwingendrehpunkt einstellbar.
Maße und Gewichte: Radstand
zirka 1390 bis 1420 mm, Lenkkopfwinkel zirka 66,5 Grad, Gewicht nach FIM-Regeln 145 kg ohne Tank, voll
einstellbare Öhlins-Telegabel vorn
mit gasdruckunterstützter Dämpfung, Zweiramschwinge hinten mit variabler Progression des Umlenksystems, voll einstellbares Öhlins-Federbein. Magnesium-Gussräder vorn 3.50 bis 3.75 x 17 Zoll, hinten 6.00 bis 6.50 x 16.5 Zoll, Michelin-Slicks.