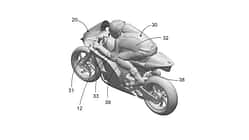Die Familie Öttl zieht als kleine, heile Welt von einer Rennstrecke zur andern. Vater Peter, fünfmaliger Grand Prix-Sieger, kümmert sich um die Organisation des Moto3-Teams. Bei den Rennen sitzt er am Computer und analysiert die Aufzeichnungen des Data Recording. Sohn Philipp kämpft sich immer näher an die WM-Spitze heran, und wenn beide nach den Trainings mit Techniker Stefan Kirsch die Köpfe zusammenstecken, hält sich Peter Öttl eher zurück. So, dass der erfahrene Papa spricht und der Sprössling nur zuhört, ist es schon lange nicht mehr, hier begegnen sich Profis auf Augenhöhe. „In die Vater-Rolle rutsche ich nur, wenn er sagt: ,Papa, wir müssen miteinander reden.‘ Wenn er kommt und Unterstützung braucht. Dann bin ich gefordert, dann muss es auch passen und überlegt sein, was ich sage“, lächelt der 51-jährige Senior. „Philipp hat ein super Umfeld, und wenn alles funktioniert, brauche ich mich nicht einzubringen.“
Krise als Wendepunkt
Schon seit vielen Jahren sind die Öttls gemeinsam unterwegs. Zu einer kleinen Krise kam es nur Ende 2014, als Philipp flügge wurde und darauf drängte, allein zum Motocross-Training nach Italien fahren zu dürfen. „Er war 18 Jahre alt, und ich musste loslassen. Das war nicht einfach und hat bei mir einige Zeit gedauert. Zehn Jahre hilfst du ihm und erklärst, wie alles funktioniert. Und jetzt plötzlich musst du das Vertrauen haben, dass er es weiß und selbst kann“, erinnert sich Peter Öttl. Es war ein Wendepunkt, an dem Philipp Öttl für sich selbst Verantwortung zu tragen begann. Kaum dass er die neue Freiheit ein paar Monate genossen hatte, kam es freilich zu einem neuen Schulterschluss, die beiden waren wieder ein Herz und eine Seele – mit dem Unterschied, dass es nun Philipp war, der die gemeinsamen Trips in den Süden organisierte. Von den Ängsten, die andere Eltern bei ihren rennfahrenden Kindern durchmachen, blieb Papa Öttl verschont. „Man hat schon früh gesehen, dass Philipp sehr überlegt zu Werke geht. Er hat einen sauberen Fahrstil und stürzt sehr selten. Ich vertraue ihm“, sagt Peter Öttl.
Helmut Bradl und Stefan Bradl
Helmut Bradl, dem zweimaligen 250er-Vizeweltmeister, war es deutlich unangenehmer, als sein Sohn Stefan begann, vom Rennfahren zu reden. „Ich wollte das nicht. Ich habe mir selbst ein paarmal wehgetan, bin aber ohne bleibende Schäden davongekommen. Doch schon zu meiner Zeit gab es einige tödliche Unfälle, jetzt auch wieder. Zwar ist das der Rennsport, wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber wenn dein eigenes Kind Gas gibt, hast du ein anderes Gefühl dabei“, erklärt der 55-Jährige. „Wenn du selbst draufsitzt, hast du die Hebel selbst in der Hand. Von draußen kannst du nur zuschauen und hoffen, dass er weiß, was er tut.“
Nie zum Fahren zu überredet
Deshalb versuchte Helmut Bradl nie, den kleinen Stefan zum Fahren zu überreden. Auch nicht, als er dem autoritär geführten Talentschuppen des Spaniers Alberto Puig im Jahr 2007 nach wenigen Wochen wieder den Rücken kehrte und damit die Chance auf einen Platz im offiziellen Repsol-250er-Team in den Wind schrieb. Erst als sich im deutschen Kiefer-Team mit Geld von Grizzly Gas die Chance ergab, neu durchzustarten und auch Stefan Bradl selbst wieder Feuer und Flamme war, half der Vater wieder mit.
"Ich bin nicht mehr verantwortlich“
Leichter ums Herz wurde ihm allerdings erst, als sein Sohn volljährig war. „Ich habe mir eingeredet: Jetzt ist er 18, ich bin nicht mehr verantwortlich“, schmunzelt Helmut Bradl. Aus nächster Nähe erlebte er den rasanten Aufstieg seines Sohnes und wich auch nicht von dessen Seite, als der Karriereweg in letzter Zeit wieder steiniger wurde. „Du kannst ihn mental aufbauen, wenn Rückschläge kommen, wenn bei ihm nichts läuft oder wenn er stürzt. Du kannst ihm neuen Mut machen“, erläutert Helmut Bradl die Vateraufgaben. Natürlich war Helmut Bradl auch bei den ersten Tests für Stefans neue Karriere in der Superbike-WM und hofft, dass sein Sohn dort Podestchancen und damit auch wieder mehr Spaß am Rennfahren hat.
Sito Pons, Axel Pons und Edgar Pons
Doch schon jetzt hat Stefan Bradl in diesem Sport mit dem Moto2-WM-Titel und dem Aufstieg in die Königsklasse mehr erreicht als sein Vater. Anders ist das bei Axel und Edgar Pons, den Söhnen des zweimaligen 250-cm³-Champions Sito Pons. Der Name Pons entspricht in Spaniens Motorsport etwa dem, was der Name Beckenbauer für den deutschen Fußball bedeutet. In die Fußstapfen eines so berühmten Vaters zu treten, ist eine schwere Aufgabe. „Wenn dein Sohn in deine Welt eintritt, um dort zu arbeiten und sich zu entfalten, ist das auf der einen Seite schön. Aber du kennst auch die Fallstricke, denn du bist selbst darüber gestolpert. Es ist leicht, zu versagen, und schwierig, zu triumphieren“, erklärt Sito Pons deshalb. „Ich habe eine andere Perspektive als andere Väter im Fahrerlager, die nicht selbst Fahrer waren.
Zunächst einmal war es mir immer wichtig, dass meine Söhne mit ihrem Leben machen, was sie selbst möchten. Ich habe sie nie unter Druck gesetzt, Rennen zu fahren – im Gegenteil, ich habe versucht, es ihnen auszureden.“ Als Vater ein guter Berater zu sein, sei eine heikle Aufgabe, fügt Pons hinzu. „Die Distanz wie zwischen einem normalen Manager und seinem Fahrer fehlt. Du redest mit einem Sohn, als ob du mit dir selbst sprichst. Du musst dich auf Distanz bringen. Das ist schwierig.“ Bei Axel Pons, dem älteren der beiden Söhne, kam ein Studium der Wirtschaftswissenschaften hinzu. Sito Pons bestand auf einem Abschluss, weshalb Axel sich nicht voll auf seine Rennfahrerkarriere konzentrieren konnte. Immerhin gelang ihm der Absprung in ein anderes Moto2-Team. „Das hatte besonderen Wert, jetzt war er ein Profi wie andere auch, nicht einfach der Sohn von Herrn Pons. Er verstand, dass er sich emanzipieren musste.“ Edgar Pons, der jüngere Sohn, fährt noch im Team des Vaters. „Doch auch bei ihm würde es mir gefallen, wenn er in ein anderes Team ginge. Es ist ein wichtiger Schritt für sie, ihre Fähigkeiten auch anderswo unter Beweis zu stellen.“
Kenny Roberts und Kenny Roberts jr.
Ob es den beiden jemals gelingt, ganz in die Fußstapfen des Vaters zu treten, steht freilich in den Sternen. Den Volltreffer landeten in dieser Hinsicht Kenny Roberts und Kenny Roberts jr. Nachdem der Vater Ende der 70er-Jahre dreimal hintereinander die Halbliter-WM gewonnen hatte, war im Jahr 2000 der Sohn an der Reihe, worauf die beiden weltweit als erstes und bislang einziges Vater-Sohn-Duo mit Titeln in der Königsklasse gefeiert wurden.
Einziges Vater-Sohn-Duo mit Titeln in der Königsklasse
Kenny jr. hatte schon als Dreikäsehoch mit Leuten wie Wayne Rainey und Eddie Lawson auf der Ranch des Vaters im kalifornischen Hinterland das Dirt Track-Fahren geübt, wuchs ganz selbstverständlich in die Blütezeit des amerikanischen Motorradsports hinein, und so selbstverständlich erschien es auch, dass er die eigene Karriere krönen und zu King Kenny jr. werden würde. Es war ein perfekter amerikanischer Traum, der erst 2016 erschüttert wurde, als sich der als Rennfahrer weniger erfolgreiche Bruder Kurtis Roberts als schwarzes Schaf der Familie entpuppte. In einem Streit auf besagter Ranch wurde Kurtis gegen den eigenen Vater handgreiflich und landete vor Gericht.
Wayne Gardner und Remy Gardner
Harmonischer geht es zwischen Wayne Gardner und seinem Sohn Remy zu. „Ich habe ein wildes, schönes, ein insgesamt unglaubliches Leben geführt“, erklärt der Halbliter-Weltmeister von 1987. „Dass ich mit Remy jetzt wieder an die Rennstrecken reise, ist ein weiterer Höhepunkt, als ob ein Kreis sich schließt“, sagt er über seinen 18-jährigen Sohn, der vor drei Jahren in die Moto3-WM einstieg und mit einer Kalex jetzt in der Moto2-Klasse vor dem Durchbruch steht. Mit welchem Einsatz Väter bisweilen für ihre Söhne unterwegs sind, zeigte der eilige Vater Gardner dieses Jahr beim Japan-Grand-Prix: Nach einer harmlosen Kollision mit einem anderen Auto an der Einfahrt zur Rennstrecke kam es zu einer ebenfalls harmlosen Rempelei zwischen den beiden Fahrern. Wayne Gardner wurde dafür, dass er seinen japanischen Gegner leicht geschubst hatte, an Ort und Stelle verhaftet und wenige Stunden vor Remys Rennen ins Gefängnis gesteckt. Erst zwölf Tage später ließ ihn die Polizei wieder laufen. Wayne Gardner: „Es war der Horror!“
Interview mit Moto3-Pilot Philipp Öttl
Philipp Öttl ist der einzige deutsche Moto3-WM-Pilot. Seit vier Jahren sucht der Sohn des ehemaligen GP-Siegers Peter Öttl Anschluss an die Weltspitze. Mit KTM-Werksmaterial fuhr er 2016 auf Rang zwölf. Er weiß: Das muss besser werden. Und er hat einen Plan. Wir haben uns nach dem Ende der Saison 2016 mit Öttl unterhalten.
MOTORRAD: Du hast deine insgesamt beste Moto3-Saison hinter dir. Was waren die Highlights?
Philipp Öttl: Es waren gute Erlebnisse dabei wie die Pole Position in Austin. Und die zwei vierten Plätze in Motegi und Austin. Auch die Rennen in Spielberg und Aragón waren gut. Doch was mir fehlte, war ein echtes Top-Ergebnis. Wobei es auch zwei Rennen gab, bei denen mir das Helmvisier angelaufen ist: in Brünn und am Sachsenring. Solche Sachen hätten nicht passieren dürfen.
MOTORRAD: Ein Glücksmoment dürfte die zweite Diagnose nach deinem unverschuldeten Sturz in Malaysia gewesen sein. Erst war von einem Kahnbeinbruch die Rede, doch dann stellte sich der Knochen als unbeschädigt heraus…
Philipp Öttl: Das war eine ziemliche Erleichterung. Nach dem Sturz war das Handgelenk angeschwollen, war rot und blau, und ich habe es nicht gescheit bewegen können. Im Medical Center von Sepang haben sie ein Röntgenbild gemacht und gesagt: „Das Kahnbein ist gebrochen.“ Dann sind wir heimgeflogen und gingen ins Salzburger Unfallkrankenhaus, um nach einem OP-Termin zu fragen. Die Ärzte sagten: „Hast eh nichts gegessen? Wir machen noch eine Computertomografie, und dann geht’s gleich los.“ Doch bei der CT kamen Zweifel auf. Die Ärzte sagten: „Ja, man könnte sich einbilden, dass man was sieht.“ Bei einer Magnetresonanztomografie drei Tage später stellte sich dann endgültig heraus: Das Kahnbein hat nichts. Das hat mich dann schon gefreut.
MOTORRAD: Zumal du dich schon ein paar Monate zuvor in Le Mans verletzt hattest…
Philipp Öttl: Ein Bruch von Elle und Speiche, der mit zehn Schrauben und einer Platte fixiert wurde. Vor der Sommerpause konnte ich deshalb nicht zeigen, dass ich schnell war, vielleicht bis auf Assen, wo ich gut dabei war, am Ende aber auch wieder nur Elfter wurde, 1,5 Sekunden hinter dem Ersten. Für die zweite Saisonhälfte wusste ich, dass ich noch schneller werden musste. Beim ersten Rennen nach der Sommerpause in Zeltweg haben wir das gut hingekriegt. In Brünn war ich Achter im Training, ohne Windschatten. Das hört sich nicht nach viel an, aber für mich war das viel. Im Jahr davor habe ich es auch allein probiert und war 23.
MOTORRAD: Du arbeitest viel an dir selbst und hast vor dem Training früher als jeder andere den Helm auf, um dich zu konzentrieren.
Philipp Öttl: 2014 war ja ein ziemlich schlechtes Jahr, und für 2015 habe ich mich dann mit einem Sportpsychologen zusammengetan. Miteinander haben wir ein gutes Programm erarbeitet, das sich immer weiter entwickelt. Für mich fühlt es sich an, als ob ich erst seit 2015 richtig Rennen fahre, weil ich mir seither im Klaren darüber bin, warum ich schnell oder langsam fahre und weil ich mir seither mit gewissen Sachen selbst helfen kann.
MOTORRAD: Du kritisierst dich selbst, aber nie dein Umfeld. Das ist bemerkenswert.
Philipp Öttl: Ich kann das Motorrad nicht infrage stellen, wenn auch die Sieger diese Maschine fahren. Auch zu meinem Cheftechniker Stefan Kirsch habe ich volles Vertrauen. Wir sind noch intensiver zusammengewachsen und haben eine spezielle Bindung. Und mein Papa ist der Grund, warum ich Motorrad fahre. Da kann man nicht sagen: Du Papa, lass es bleiben, ich suche mir einen anderen.
MOTORRAD: Wie würdest du das Verhältnis zu deinem Vater beschreiben? Als eine Freundschaft auf Augenhöhe oder als Sohn-Vater-Beziehung?
Philipp Öttl: Beides, wobei ich das Verhältnis Vater – Sohn nicht als Problem ansehe.
MOTORRAD: War es eine heikle Phase, als du auf eigenen Füßen stehen wolltest und dein Vater lernen musste, die Zügel länger zu lassen?
Philipp Öttl: Das war ein kurzer Prozess, der hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert und am Anfang einen Keil zwischen uns getrieben. Da gab es schon Reibungen, bis beide Seiten erkannten, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ich meine Sachen mal alleine mache. Jetzt sieht er: Mein Sohn hat seine Erfahrungen gemacht, jetzt will er mich wieder dabeihaben.
MOTORRAD: Versucht er dir viel zu erklären, was den Rennsport und das tägliche Leben angeht?
Philipp Öttl: Nein. Für mein Training habe ich meinen Trainer und für das Psychologische habe ich meinen Sportpsychologen. Da fragt er gelegentlich ein paar Sachen, und die sage ich ihm auch. Es herrscht Vertrauen, weil es ganz gut funktioniert.
MOTORRAD: Und an der Strecke?
Philipp Öttl: Er vertieft sich in die Daten, und wenn ich ihn frage, wie schaut’s dort und dort aus, weiß er gleich Bescheid. Manchmal brauch ich das, manchmal brauch ich es nicht. Er drängt mir nichts auf, es sei denn, es ist absolut notwendig.
MOTORRAD: Reden wir über die Kollegen. Was fällt dir auf, wenn du gegen Brad Binder fährst?
Philipp Öttl: Er ist einfach konstant schnell. Im Vergleich zu den anderen wirkt er erwachsener. Er ist sehr stark, schnell, konstant, immer zur Stelle, fehlerfrei.
MOTORRAD: Welchem Fahrer willst du es unbedingt zeigen?
Philipp Öttl: Jedem! Der vor dir ist der Nächste, wenn du ihn überholen kannst, überholst du. Egal wer das ist.
MOTORRAD: Dass du ebenso hart fahren kannst wie die Spanier, sieht man an deinen Aufholjagden. Doch was passiert mit dir bei den Starts?
Philipp Öttl: Der Start ist nicht immer einfach. Ab und zu bringe ich es gut hin, ab und zu nicht so gut. Dafür habe ich noch nicht das perfekte Rezept. Für mich ist es schon gut, wenn ich den Platz halten kann. Es kommt auch darauf an, wo ich stehe. Wenn ich weit vorne stehe wie in Aragón, dann passt es, dann bin ich gleich im Rhythmus. Wenn ich weit hinten stehe, tue ich mich ab und zu noch ein bisschen schwer.
MOTORRAD: Kannst du sagen, wovon du träumst?
Philipp Öttl: Da ist schon der Traum, aufzusteigen und dann noch einmal aufzusteigen und die einzelnen Klassen jeweils mit einem WM-Titel zu krönen. Das ist der optimale Plan. Wenn du dann auch noch dein Motorrad wählen kannst, ist das schierer Luxus. Wenn KTM zum Beispiel meint, fahr auf WP oder auf KTM Moto2 und fahr dann MotoGP, ist das kein Angebot, das ich ablehnen würde.
MOTORRAD: Was fehlt zum großen Erfolg im nächsten Jahr? Einfach ein Quäntchen Glück?
Philipp Öttl: Wir wollen unseren Plan im Winter forcieren und weiterentwickeln. Ich habe mir in jedem Training aufgeschrieben, was passiert ist, das werde ich mir durchlesen und schauen: Das ist mir öfter passiert und darauf muss ich achten. Bei der Fitness kannst du nicht mehr viel holen, da sind alle Fahrer auf einem brutal hohen Level. Alle haben ein starkes Motorrad und alle haben ein gutes Team. Aber ich habe etwas entdeckt, was ich tun kann, um noch schneller zu werden, und es macht richtig Spaß zu sehen, wie sich was auswirkt auf mein Fahren. Ein Beispiel, das man in jeder Lebenslage anwenden kann: Bevor man was macht, muss man schauen, dass die Ausgangslage passt, dann kann man optimal an die Sache rangehen. Zum Beispiel muss ich vor dem Rausfahren schauen, dass die Lederkombi nicht zwickt. Das ist ein kleiner Teil, aber wenn du es auf dem Motorrad machst, bist du schon abgelenkt. Passt der Handschuh, sind meine Haare am rechten Fleck? Das kannst du auch machen, wenn du im Winter ans Fitnessgerät gehst. Du stellst dein Gewicht, die Sitzposition, die Hebel sorgfältig ein. Da hast du schon etwas geübt, bevor das Training überhaupt begonnen hat.
(Anmerkung: Das Interview wurde bereits im Winter 2016 geführt)