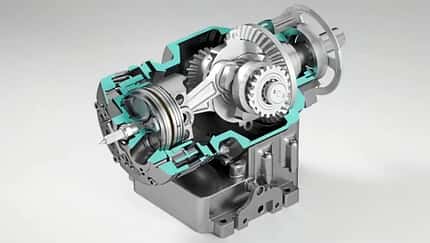Stellen Sie sich vor, Sie würden mit der Aufgabe konfrontiert, einen Motorradmotor zu entwickeln, der leistungs- und drehmomentstark zugleich, gutmütig und temperamentvoll, dabei aber sparsam sein soll, wenig Bauraum beanspruchen darf, der möglichst leicht sein soll, aber zuverlässig für über 150.000 Fahrkilometer, der günstig zu fertigen sein, aber zugleich einen gewissen Haben-wollen-Reflex auslösen soll.
Der weiterhin wenig Wartung verlangt, wenn sie aber nötig wird, gut zugänglich sein soll. Der mit möglichst wenig Anpassungen auf der ganzen Welt funktionieren soll, in allen Klimazonen auf allen erreichbaren Meereshöhen, mit brasilianischem Benzin, das mindestens 25 Prozent Bio-Ethanol enthält – quasi E25 –, oder mit Benzinqualitäten, die ...