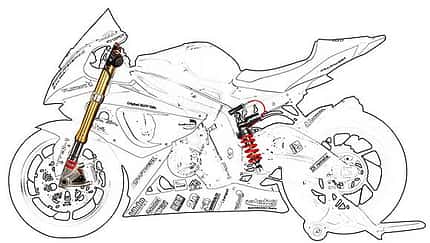Unsere Urgroßväter bretterten noch auf Motorrädern mit Starrrahmen durch die Gegend. Eine recht holprige Angelegenheit, bei der jede Zerklüftung des Untergrunds Fahrer und Maschine malträtierten. Mittlerweile dürfen wir uns über moderne und hochwertige Federelemente freuen, die eine Reihe an Einstellmöglichkeiten bieten - unter anderem an der Federung.
Doch wozu einstellen? Weil diese schwungvoll gewickelten Drahtgebilde vorn und hinten einen Großteil des Fahrzeuggewichts inklusive Passagier(e) und Gepäck tragen, und das Fahrwerk mit all seinen Komponenten sein ganzes Potenzial nur korrekt justiert entfalten kann. Wichtig dabei ist, dass die Federhärte von Gabel und Monoshock zum Fahrergewicht, dem Fahrstil und dem Einsatzzweck passt. Der Fachjargon spricht bei der Federhärte auch von Federrate.
Stimmen die jeweiligen Federhärten, ist alles paletti. Bei zu harten Gabelfedern hilft ein Trick: Im Innern der Gabel fließt Öl, das nicht nur die Dämpfung übernimmt, sondern auch die Federarbeit beeinflusst. Die Forke ist aber nicht komplett mit Öl gefüllt. Unterhalb des oberen Gabelstopfens existiert ein Zwischenraum, das Luftpolster. Beim Einfedern wird diese Luft komprimiert, was die -Federung bei zunehmendem Eintauchen der Gabel progressiv „verhärtet“. Sind die Federn zu hart, kann es helfen, das Luftpolster zu vergrößern, also etwas Öl abzuzapfen. Dadurch sinken die benötigten Kräfte fürs Einfedern, da sich ein großes Luftpolster leichter verdichten lässt als ein kleines. Dem Trick, das Luftpolster zu variieren, sind allerdings Grenzen gesetzt. Mehr als fünf bis maximal zehn Prozent der Federhärte sollten mit dieser Maßnahme nicht ausgeglichen werden.
Die gute Nachricht: Die Methode funktioniert auch anders herum. Heißt: Bei zu weichen Federn hilft ein kleineres Luftpolster, also etwas mehr Ölvolumen, damit die Gabel weniger weit eintaucht und später oder gar nicht durchschlägt. Auch hier gibt es Grenzen beim Kompensieren der Federraten. Je mehr Öl und je weniger Luft in der Gabel ist, desto mehr Überdruck baut sich beim Einfedern im Gabelinnern auf, was zu Undichtigkeiten der Forke führen kann. Ein zu geringes Luftpolster wirkt sich außerdem negativ aufs Ansprechverhalten der Gabel aus, da die Progression der Federkraft mit zunehmendem Ölstand immer steiler ansteigt. Die untere Grafik auf Seite 69 veranschaulicht dieses Prinzip. Dazu steigt bei einem stark komprimierten Luftpolster die Reibung der Dichtlippen an den Simmerringen, was die Losbrechkraft („Slipstick-Effekt“) der Gabel erhöht und damit ebenfalls das Ansprechverhalten verschlechtert. Um das Luftpolster beziehungsweise den Ölstand zu messen, müssen die Gabelfedern ausgebaut werden. Das benötigt gewisse Schrauber-Kenntnisse. Wer sich diese Arbeiten zutraut, sollte in kleinen Schritten vorgehen und den Ölstand um nicht mehr als zehn Millimeter auf einmal korrigieren.
Dieser Kniff zieht beim Federbein nicht, denn dort gibt es schlicht kein Luftpolster, das die Wirkung der Feder so direkt unterstützt wie bei der Gabel. Fällt sie zu weich aus, kann eine etwas stärkere Vorspannung dieses Manko in gewissem Maß ausgleichen. Ein Beispiel: Eine „hunderter Feder“ (Fachjargon) meint eine Federhärte von 100 N/mm. Das -bedeutet, dass auf die Feder eine Kraft von 100 Newton (N) wirken muss, um sie -einen Millimeter (mm) zu komprimieren. 100 Newton entsprechen etwa einer Gewichtskraft von 10 (exakt: 10,2) Kilogramm. Spannt man eine Feder dieser Härte zehn Millimeter vor, wirkt also eine Kraft von rund 100 Kilogramm oder 1000 Newton. In unserem Beispiel stützt das Federbein in eingebautem Zustand das auf ihr lastende Gewicht von Maschine und Fahrer mit dieser Kraft ab. Genügt das nicht, federt das Heck also zu weit ein, hebt weiteres Vorspannen das zu tief stehende Heck an. Das geschieht, weil die erhöhte Vorspannung den Stoßdämpfer weiter auseinander zieht (weniger Negativfederweg, mehr Positivfederweg) und sich damit die sogenannte Federbasis und dadurch das Rahmenheck nch oben verlagert. Nachteil: Je stärker die Vorspannung (Englisch: preload), desto unkomfortabler arbeitet der Monoshock im Anfangsbereich seines Federwegs. Das macht sich beispielsweise bei hartem Anbremsen bemerkbar, wenn bei ausgefedertem Heck Asphaltfurchen die Federung aufmischen. Auch auf holprigem Geläuf, wo das Bike oft weit ausfedert, werkelt ein stark vorgespanntes Federbein anfangs unsensibel.
Im Umkehrschluss „entschärft“ weniger Vorspannung eine zu harte Feder im Anfangsbereich. Aber auch hier funktioniert das nur begrenzt, denn alle Eingriffe beeinflussen die eingangs erwähnte Federbasis und damit auch Balance, Geometrie und Fahrverhalten des Bikes.

Ein Beispiel bei der Gabel verdeutlicht diese Gegebenheit. Auch sie reagiert auf verschieden stark vorgespannte Federn. So erhöht mehr Vorspannung die Fahrzeugfront, wodurch das Bike unhandlicher wird und weitere Bögen fährt. Außerdem begünstigt dieser Zustand das gefürchtete Lenkerschlagen. Zu wenig vorgespannte Federn senken die Front dagegen ab, das Bike wirkt nervös und instabil. Zudem läuft die Forke früher -gegen ihren mechanischen oder hydraulischen Anschlag. Die Umgangssprache nennt diesen Zustand „auf Block gehen“. Ist das der Fall, absorbieren die Federn keine Energie mehr. Das muss nun der Vorderreifen übernehmen. Der ist dabei aber schnell überfordert und blockiert - autsch! Serienmäßig stecken nicht in jedem Bike Federn mit perfekter Federrate, bisweilen fallen sie zu weich aus. Speziell bei sehr sportlicher Gangart - Stichwort Rennstrecke - ein echtes Dilemma. Passende Federhärten zu verwenden, ist also in jedem Fall ratsam.
Thema Rennsport. Professionelle Rennställe wie das Alpha Technik-Van Zon-Kraftwerk-BMW-Team in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) arbeiten mit ausgeklügelten Verhältnissen zwischen Federhärte und Vorspannung, die sie oft auf die entsprechende Strecke neu angleichen. Grundsätzlich kommen beim Zirkeln eher harte Federn zum Einsatz. Das lindert störende Nickbewegungen und die damit einhergehenden Änderungen der Geometrie - der Renner bleibt stabil in der gewünschten Lage. Steht bei Regenrennen viel Wasser auf der Piste, greifen Teams auf weichere Federn (Federrate zirka minus zehn Prozent) zurück und passen die Dämpfung entsprechend an. Oft bauen sie sogar eigens abgestimmte Federelemente ins Bike.
Den meisten Hobbypiloten ist dieser Aufwand zu groß und zu kostspielig. Doch auch sie sollten bei Regen zumindest das Setup soften - weniger Federvorspannung und Dämpfung - , denn auf nasser Strecke ist ein sanftes Ansprechverhalten der Federelemente entscheidend. Weiterer Tipp für Hobbyisten: Wer die Sekundärübersetzung (Ritzel, Kettenrad) angleicht, ändert automatisch die Position des Hinterrads in der Schwinge - es wandert entweder weiter vor oder zurück. In beiden Fällen variieren Hebel und Kraft, die auf die Federung wirken. Bei größeren Verschiebungen sollte der Freizeitsportler also checken, ob die verwendete Federhärte noch passt.
Parallel zu den Berichten im Heft stellen wir für das Fahrwerk-Spezial jeweils ein Video auf www.ps-onlinde.de, das die geschilderten Setup-Schritte veranschaulicht. Der erste Film läuft bereits - viel Spaß beim Anschauen. In der nächsten Ausgabe behandeln wir das Thema Dämpfung. Sie ist untrennbar mit der Federung verbunden. Generell lohnt es sich, Zeit und auch Bares ins Fahrwerk zu stecken. Denn mit einem top abgestimmten Chassis zu brennen macht tierisch Laune. Und verdammt schnell!

Wichtig für die Federarbeit ist ein gewisses Verhältnis von Positiv- zu Negativfederweg, also vom Ein- zum Ausfederweg. Um dieses Verhältnis sicherzustellen, prüft man zunächst den sogenannten statischen Negativfederweg (Englisch: sag). Das ist jenes Maß, um das die Federelemente aufgrund des Eigengewichts vom Motorrad - also ohne Fahrer - einfedern. Sportliche Straßenmotorräder haben sowohl bei der Gabel als auch beim Federbein in der Regel einen Gesamtfederweg von zirka 120 Millimetern. Bei der Gabel beträgt das „sag“ 25 bis 35 Millimeter. Um es zu prüfen, entlastet man als erstes das Vorderrad.

Wer keinen Spezial- oder Hauptständer hat, braucht einen Helfer, der das Bike über den Seitenständer zieht. Nun misst man die Distanz des Innenrohrs zwischen der Staubkappe (oben) und dem Gabelfuß, in dem das Innenrohr steckt.

Dieses Maß notieren. Anschließend das Bike vom Ständer nehmen und einige Male durchfedern. Dann erneut zwischen diesen beiden Punkten messen. Durch das Eigengewicht der Maschine sollte die Federung um den angegebenen Wert nachgeben. Tut sie das nicht, die Feder über die Vorspanneinrichtung oben am Gabelstopfen entsprechend justieren.

Ist der statische Negativfederweg korrekt eingestellt, setzt sich der Pilot in Fahrerhaltung auf das Bike, die Maschine bleibt abgebockt.
Nun sollte die Gabel um weitere zehn Millimeter eintauchen. Diesen Zustand nennt man „Negativfederweg belastet“ oder „Negativfederweg mit Fahrer“. Sinkt die Forke weiter ein, ist die Feder für diesen Piloten zu weich, gibt sie weniger nach, zu hart. Negativfederweg ist nötig, damit Gabel oder Monoshock bei der Ausfederbewegung nicht sofort an ihren oberen Anschlag gelangen.

Wie die Gabel benötigt auch das Federbein Negativfederweg. Bei einem Gesamtfederweg von gängigen 120 Millimetern beträgt er zirka zehn Millimeter. Für den Check muss auch der Monoshock komplett entlastet sein. Dazu eignet sich beispielsweise ein Fußrastenständer.

Sonst muss das Hinterrad wieder über den Seiten- oder Hauptständer entlastet werden. Nun misst man die Distanz zwischen der Radachse und einem Punkt oberhalb des Rahmenhecks und notiert dieses Maß.

Dann das Bike mit beiden Rädern auf den Boden stellen, das Heck einige Male durchfedern und erneut an denselben Punkten messen. Weicht der statische Negativfederweg vom Soll ab, die Vorspannung entsprechend anpassen. Gut ausgestattete Federbeine bieten dafür eine Hydraulik.

Bei allen anderen Modellen variieren Kronenmuttern über ein Gewinde oder eine Rasterung die Vorspannung. Anschließend setzt sich der Pilot in Fahrerhaltung auf die Maschine. Nun misst man wieder die Distanz zwischen den bekannten Punkten.

Durch das Gewicht des Fahrers sollte die Feder weitere 15 (Rennsport) bis 25 Millimeter (Sänfte) nachgeben. Der komplette Negativfederweg beträgt bei belasteter Maschine demnach ungefähr zwischen 25 und 35 Millimeter. Dank ausgeklügelten Zusammenspiels zwischen dem Umlenkhebel, den Zugstreben sowie deren Anlenkpunkten „verhärtet“ sich die Federung umso stärker, je weiter der Monoshock einfedert. Diese „Umlenkung“ stellt sicher, dass das Federbein bei hoher Belastung nicht abrupt an seinen Anschlag gerät. Um einen zu sprunghaften Anstieg der Federkraft zu vermeiden, arbeiten die Hersteller heute mit eher geringen Progressionen. Fürs Arbeiten mit der Federung auch wissenswert: Der Schwingenwinkel und der Abstand der Radachse vom Hinterrad zum Schwingendrehpunkt bewirken, dass der Einfederweg direkt am Federbein und der Weg am Rahmenheck voneinander abweicht. Das Übersetzungsverhältnis beträgt ungefähr 1:2. Heißt: Federt der Monoshock beispielsweise um 40 Millimeter ein, beträgt der Weg am Rahmenheck zirka 80 Millimeter.

Bei Gabeln längst Standard: Top-out-Federn. Die vergleichsweise kleinen Zusatzfedern verhindern, dass die Forke bei der Ausfederbewegung brutal gegen ihren mechanischen Anschlag knallt. Bei aufgebockter Maschine und entlastetem Vorderrad kann man die Federn bei sanftem Abwärtsdruck auf das Rad spüren.

Pro Gabelholm werkelt je eine Top-out-Feder. In unserem Beispiel sitzt sie auf der Dämpferstange des bewegten Kolbens.

Eine Top-out-Feder wirkt grundsätzlich gegen die Kraft der Hauptfeder, beide beeinflussen sich gegenseitig. Ein gelungenes Feder-Setup setzt für beide Typen geeignete Federraten und eine passende Vorspannung voraus. In Federbeinen kommen Top-out-Federn vorzugsweise im Rennsport zum Einsatz. Da sie eine sehr hohe Federrate aufweisen, benützen Rennteams spezielle Vorrichtungen, um die maximale Länge des Monoshocks zu ermitteln. Klein, hart, kurz: So sieht eine typische Topout-Feder für ein Racing-Federbein aus.