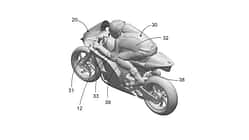Corrado Checcinelli, oberster Techniker
im Ducati Corse-Clan, gibt die letzten knappen Anweisungen, bevor MOTORRAD den roten Teufel über die GP-Piste von
Valencia treiben darf. »Vorsicht mit der
Motorleistung, wir haben weder Traktions- noch Wheelie-Kontrolle. Have fun dont crash. Alles klar. Die Desmosedici war
bereits im letzten Jahr ein Stück pure
Mechanik, auf elektronischen Hokuspokus wurde weitgehend verzichtet. Daran hat sich 2004 nichts geändert.
Die Italiener versuchen entgegen dem Trend in der Königsklasse des Motorradsports ihr Sportgerät so zu optimieren, dass der Fahrer die schiere Gewalt des
90-Grad-V-Motors auch ohne elektronische Fahrhilfen und Computersteuerung nicht fürchten muss. Was bei Werksfahrer Loris Capirossi wohl sogar bei doppelter Leistung kein Thema wäre, beim durchschnittlich begabten Motorradfahrer mit
einem gesunden Selbsterhaltungstrieb schon. Allein deshalb, weil der 990er-
Motor bereits beim Startprozedere mit schmerzhaft donnerndem Getöse für Respekt sorgt. Schalthebel hoch, eine Spur am Gas gedreht, und los gehts.
Vier bildschöne Megaphone aus hauch-
dünnem Titanblech, komplett ungedämpft, hämmern einen unvergleichlichen Sound aufs Trommelfell und künden vom neuen Arbeitsprinzip des Ducati-Antriebs: Twin Pulse, eine Zündfolge, die der Arbeitsweise eines doppelten Zweizylinders entspricht. Und sonst? Alles beim Alten. In bester
Ducati-Tradition fräst die Desmosedici wie hingedübelt über die Bahn und demonstriert wie alle Topmodelle der MotoGP-Weltmeisterschaft, welch enormes Potenzial in einem Motorrad steckt, bei dem Chassis, Reifen und Federsysteme optimal aufeinander abgestimmt sind. Eine Stabilität und eine Präzision, die schwer zu beschreiben sind: Kein Besitzer einer Serien-Ducati
wird es für möglich halten, dass das satte,
souveräne Kurvenverhalten einer 998 oder 999 nicht nur um Nuancen, sondern um Welten zu verbessern ist.
Das ändert aber nichts daran, dass der Desmosedici mit der Startnummer 12 des nach der Saison 2004 entlassenen Werkspiloten Troy Bayliss immer noch mit engagiertem Körpereinsatz und Armschmalz die Richtung diktiert werden muss auch das ist Ducati-Tradition. Eine Angelegenheit, die je nach Auslegung von Lenkgeometrie und der Feder-/Dämpferabstimmung etwas einfacher über die Bühne gehen kann, wie etwa von Loris Capirossi bevorzugt, allerdings mit Einbußen bei der Stabilität oder der Reifenhaftung.
Wer die spektakuläre Show der
MotoGP-Piloten live oder per TV erlebt hat, wird sich fragen, warum nicht nur die Ducatis bei manch mörderischem Beschleunigen in Schräglage ihre Stabilität blitzartig einbüßen, sich des Öfteren brutal aufschaukeln und kaum mehr zu bändigen sind. Drei wichtige Parameter spielen dabei ein Rolle. Zum einen werden in dieser
Phase die Reifen durch die Umfangskräfte, also die Übertragung der Motorleistung, stark verformt, gleichzeitig beeinflusst der Kettenzug je nach Schwingenposition das Federsystem, und letztlich verwinden sich je nach Auslegung Rahmen und Schwinge. Alle drei Elemente wirken wie Federn, die sich bei einer bestimmten Überlagerung der Frequenzen so aufschwingen, dass die MotoGP-Renner wild und scheinbar ungezähmt wie ein Rodeo-Pferd bocken.
Was auf den ersten Blick nach einem zu weichen und schlecht gedämpften Fahrwerk aussieht, kann im Grunde das Gegenteil sein: ein zu steifer Rahmenverbund oder eine zu harte Federung oder Dämpfung. Mit gezielten, aber zeitaufwendigen und teuren Maßnahmen können die Techniker aus einem Mix von unterschiedlich steifen Rahmen oder Schwingen,
Federbeinabstimmungen oder Reifen mit härterer oder weicherer Karkasse eine
gute Lösung austüfteln besser gesagt: einen guten Kompromiss. Nur mit derartiger Feinabstimmung ist es möglich, die
schiere Gewalt von über 240 PS in gute Rundenzeiten umzumünzen.
Auffallend an der Desmosedici: Der Motor kommt im Vergleich zur Honda
RC 211 V (Fahrbericht in MOTORRAD 26/ 2004) unter 9000/min eher schwachbrüstig daher. Ein Umstand, den die geradezu
frivole Drehfreudigkeit des Desmo-V4 von bis über 17000/min locker kompensiert. Und ein tatsächlich nutzbares Leistungsband in ähnlicher Breite wie bei der
Honda garantiert Leistung und Drehmoment im Überfluss. Deshalb macht sich der MotoGP-Neuling höchst bedächtig am Gasgriff zu schaffen und wetzt lieber einen Gang zu hoch als einen zu niedrig durch die Kurven. Feiner in der Dosierung als beim 2003er-Modell lässt sich das Gas in Schräglagen zart anlegen, um am Kurvenausgang mit einem lässigen Dreh und mit
aller Macht davonzuschnellen.
Untypisch für einen 90-Grad-V-Antrieb: die derben Vibrationen, die unter hoher Last am Gitterrohrrahmen rütteln. Mit dem Massenausgleich hat das Treiben des
Poltergeists weniger zu tun, schon eher sind dafür die hohen Arbeitsdrücke der zeitgleich zündenden Zylinderpaare (Twin-Pulse-Prinzip) verantwortlich. Seit dem
Assen-GP im Juni verwendet Ducati dieses Prinzip, das bereits in den ersten Tagen der Desmosedici erprobt, doch aufgrund zu hoher Spitzenbelastungen und kapitaler Schäden in Antrieb und Getriebe vorerst
zu den Akten gelegt wurde. Der Vorteil: Die Kraftübertragung zum Reifen erfolgt ähnlich schonend wie bei den Zweizylinder-Superbikes, die Motordrehzahl und somit die Leistung lässt sich indes durch die
kleineren Einzelhubräume und geringeren Massenkräfte deutlich erhöhen. Ein Zweizylinder-Superbike mit etwa gleichem Hubraum (999 cm3) bringt es auf 200 PS bei einer Höchstdrehzahl von etwa 13000/min.
Dabei hat das Twin-Pulse-Prinzip nur
minimalen Einfluss auf die tatsächliche Motorleistung. Auch der oft kolportierte bessere Durchzug, also mehr Drehmoment, ist mit Twin Pulse nicht zu machen. Schließlich ist die messbare Leistungs-
ausbeute ein Produkt der einzelnen Ar-
beitstakte. Und die sind beim Twin-Pulse-Motor nicht mehr und auch nicht hefti-
ger, sondern lediglich gebündelt. Vielmehr ändert sich durch die Zusammenlegung der Arbeitstakte die Kraftübertragung
zwischen Fahrbahn und Hinterreifen. Der soll sich beim Twin-Pulse-Prinzip weniger erhitzen, was über die Renndistanz zu
besseren Rundenzeiten verhilft und im Drift einfacher zu kontrollieren sei. Das wiederum schützt den Piloten vor wüsten Highsider-Stürzen.
Über 240 PS, so die sehr diskrete
Angabe der Ducati-Ingenieure, katapultierten die Werksfahrer bei den Vorsaison-Tests Ende März in Barcelona auf 347,7 km/h und machten die Desmosedici
zum schnellsten Bike im MotoGP-Zirkus. Hauptverantwortlich für die beeindruckenden Topspeed-Werte ist die großflächige Kohlefaser-Verkleidung mit einer ausgeprägten Kuppel, die den geduckten Fahrer perfekt integriert. Während Honda und Yamaha zugunsten eines besseren Handlings in schnellen Kurven auf die optimale Aerodynamik mit sauberer, laminarer Strömung verzichten und eher aufs knapp geschnittene, zerklüftete Kleid setzen, hält Ducati an den rundlichen, windschlüpfigen Konturen auch bei der 2005er-Variante fest.
Stellt sich nach den ernüchternden
Resultaten der vergangenen Saison die Frage, ob die Italiener mit ihrer Philosophie von der möglichst simplen Fahrmaschine den Anschluss an die Konkurrenz verlieren. Denn egal, ob Honda, Kawasaki oder Yamaha, alle setzen verstärkt auf elek-
tronisch unterstützte Fahrhilfen sei es
die Launch-Control, also die Starthilfe, oder die Schlupfregelung beim Beschleunigen, die die PS-Monster nicht nur schneller, sondern auch sicherer machen. Kaum ein Fahrerduo stürzte sich in der letzten Saison öfter aus den Rennen als die Ducati-Werks-Piloten. Speziell der Australier Troy Bayliss beendete sechs von 16 Weltmeister-Läufen im Kiesbett.
Man darf nun gespannt sein, wie sich die Desmosedici gegen die fernöstliche Übermacht 2005 zur Wehr setzt. Wobei Carlos Checa, der den zu Honda abgewanderten Bayliss ersetzt, mit der neuen Ducati bereits ein Rauchzeichen aufsteigen ließ: sensationeller Rundenrekord bei den Jerez-Tests Ende November. Und das auf einem für ihn völlig neuen Motorrad.
Ducati Desmosedici MotoGP-Rennmaschine (FB) - Ducati Desmosedici GP4
Motor: wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor, Leistung zirka 240 PS bei 16500/min, maximales Drehmoment 100 Nm bei 14000/min, je vier desmodromisch gesteuerte Ventile, elektronisches Marelli-Motormanagement, Vier-in-vier-Auspuffanlage, Trockenkupplung mit Anti-Hopping-System, Sechsgang-Kassettengetriebe.
Fahrwerk: Gitterrohrrahmen aus Chrommolybdän-Stahl, Motor tragendes Element mit
integrierter Schwingenlagerung, selbsttragendes Kohlefaser-Rahmenheck, 42er-Öhlins-Upside-down-Gabel mit gasdruckunterstützter Dämpfung, Zweiarmschwinge aus Alu-Formteilen, Öhlins-Federbein mit oberer Abstützung an der Schwinge, Kohlefaserbremsscheiben vorn, Ø 320 mm, Brembo-Vierkolbenzangen, Magnesium-Räder, vorn 3.60 x 16,50 Zoll, hinten 6.50 x 16,50 Zoll