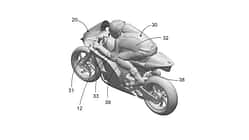Weltmeister wird man nicht mit
billigen Kopien, sondern nur mit eigenen Ideen und Konzepten«, erkannte bereits vor Jahren Aprilias Renndirektor Jan Witteveen. Seine Mannschaft hievte das Jahrhunderttalent Valentino Rossi mit der 125er- und 250er-Drehschieber-Aprilia auf den WM-Thron, bevor der lebenslustige Italiener bei Honda andockte. Dort nagelte er bei den 500ern und dann in der MotoGP-Klasse die WM-Titel drei, vier und fünf fest.
2004 wechselt Valentino Rossi zu Yamaha, um deren bislang eher blasse Bilanz in der Formel 1 des Motorradsports aufzupolieren. Nach elf Jahren ohne Titel in der großen GP-Klasse und mit Carlos Checa auf dem enttäuschenden siebten Rang der aktuellen WM ist das Yamaha-Lager jetzt zu allem bereit. Wenn gar nichts mehr geht, könnte auch ein bereits im Versuch laufender V6-
Motor Meister Rossi zu mehr Power verhelfen. Vorerst bleibt das 2003er-Konzept jedoch bestehen.
Der zierliche, 990 cm3 große Reihen-Vierzylinder mit rückwärts drehender
Kurbelwelle bei der Konkurrenz rotiert sie konventionell vorwärts wird derzeit auf der elektronischen Seite von Magneti-Marelli aufgerüstet und in Sachen Fahrbarkeit optimiert. Auffallend an der YZR-M1: Das Motorgehäuse ist komplett aus dem Vollen gefräst, womit sich Modifikationen durch Änderungen des CNC-Programms relativ schnell umsetzen
lassen, ohne ganze Gussformen neu gestalten zu müssen.
Betätigt werden die mutmaßlich vier Ventile pro Zylinder nach Insider-Informationen warf Yamaha beim MotoGP-Prototyp die hauseigene Fünfventil-Technik wie bei den supersportlichen Big
Bikes à la R1 über Bord durch eine Kombination aus kurzer Kette und einem Zahnrad-Trio zu den beiden oben liegenden Nockenwellen. Huckepack hinter der Zylinderbank liegt die Lichtmaschine, womit sich die Baubreite des Vierzylinders rigoros reduzieren ließ.
Den Gasdurchfluss im mächtigen Ansaugtrakt regeln rollengelagerte Flachschieber anstatt der sonst üblichen
Drosselklappen. Weit über den polierten Ansaugtrichtern positioniert, vermengen die Düsen der Einspritzung den Kraftstoff mit der Ansaugluft. Zirka 240 PS bei einer maximalen Drehzahl von 15000/min gibt Yamaha für den YZR-M1-Motor an. Genug, um rein leistungsmäßig mit den
Siegermaschinen von Honda und Ducati mitzuhalten.
Das Problem hoch verdichteter Renntriebwerke in Verbindung mit extrem
geringen Schwungmassen des Kurbeltriebs: Die Bremswirkung des Motors
ist enorm und lässt das Hinterrad beim Einlenken aus der Spur rutschen. Yamaha hebt deshalb mit einer komplizierten Steuerung zwei der vier Gasschieber beim Bremsvorgang an, das Aggregat läuft mit erhöhter Drehzahl nach. Jeder
Fahrer erhält dabei sein spezielles Programm, das die Dauer und die Intensität dieses Vorgangs regelt. Zusätzlich kappt eine Rutschkupplung die Spitzen des
Motorbremsmoments, um zu verhindern, dass eine Resonanzschwingung im Antriebsstrang das Hinterrad stempeln lässt. Bereits solche Feinheiten verdeutlichen, dass die MotoGP-Geschosse nicht lässig aus dem Handgelenk zu dirigieren sind, sondern durch ein ganzes Bündel an Tricks und Raffinessen gezähmt werden müssen.
Technik-Chef Ichiro Yoda setzt bei der YZR-M1 auch beim Fahrwerk auf
diverse frei wählbare und voneinander unabhängige Einstellmöglichkeiten. Ob Motorposition, Lenkgeometrie, Schwingendrehpunkt, Federprogression oder Sitzhaltung des Fahrers, sämtliche Parameter sind variabel und ermöglichen
unzählige Abstimmungen. Wobei »Radio Fahrerlager« vermeldet, dass gerade in diesem Umstand ein Teil der Problematik zu suchen sei. Nicht selten verrennt sich ein Yamaha-Pilot im Labyrinth der Möglichkeiten, anstatt mit einer passablen Fahrwerksabstimmung und fahrerischem Ehrgeiz auf Zeitenjagd zu gehen. Mäßige Rennergebnisse lassen sich ohne zu
zaudern aufs miserable Set-up schieben.
Eine prima Voraussetzung für den
15 Minuten langen Ritt mit der YZR-M1 auf der WM-Piste von Valencia. Sollte irgendwas daneben gehen, kanns ja nur an der Abstimmung liegen. Die Startmaschine, jene eigenartige Mischung aus Rasenmäher und einrädrigem Go-Kart, wird angedockt, und der Vierzylinder brüllt aus dem Ofenrohr-großen »Schalldämpfer« los. Die M1 besitzt eine superschlanke Taille sowie ein makellos arrangiertes Dreieck aus Lenker, Rasten und Sitzbank. Problemlos raste ich im Cock-
pit ein wie ein guter Skischuh in der
Bindung. Bereits zartes Antippen des Schalthebels klickt die Gänge federleicht in ihre Position. Kupplung, Gas, alles ist messerscharf dosierbar, wie sich das für ein Millionen teures Werksgerät gehört.
Himmeldonnerwetter, was für ein Leichtgewicht. Fühlt sich an wie eine 110-Kilo-250er auf 150er-Reifen, aber nicht wie eine 165-Kilo-Granate auf 190er-Schlappen. Schnippt beim bloßen Gedanken in Schräglage, Lenkkraft gleich null. Was soll da noch schief gehen? Vorderrad hoch und rein ins Vergnügen. Vergnügen? Puls 200, Panik, Schweißausbruch. Beim ersten Versuch, zackig einzubiegen, läuft der Motor gut zwei
Sekunden nach und schiebt Mensch
und Maschine auf der Außenbahn ums Eck. Genau wie einst bei den Yamaha-
TZ-Zweitaktern, wenn die Gasschieber klemmten, hat an der YZR-M1 jedoch, wie bereits erwähnt, andere Gründe. »Das Bremsmoment des Motors wird je nach Fahrer und Strecke zum Teil drastisch reduziert, das passt nur, wenn der Pilot von voller Beschleunigung ohne Zögern brutal in die Eisen langt«, erklärte noch vor fünf Minuten Datarecording-Mann Dirk Debus den Trick mit den Gasschiebern. Für mich ist das Thema erledigt, zumal das Spiel nicht bei allen Kurven identisch abläuft. Je nach Geschwindigkeit und Drehzahl saust die Yamaha nach dem Schließen des Gasgriffs mal mehr, mal weniger schwungvoll weiter.
Folglich verzichte ich auf halbwegs passable Bremsmanöver und wende mich den angenehmeren Seiten der M1 zu. Beispielsweise dieser unglaublichen Leichtfüßigkeit, die sich bei der verzweifelten Suche nach der Ideallinie indes nicht unbedingt als förderlich erweist. Fast schon kippelig und nervös, fordert die Yamaha maximale Konzentration beim Einlenken. Grobschlächtiges Reißen und Herumwerfen beantwortet die sensible Diva mit einer Linie, bei der man gehörig aufpassen muss, dem Streckenposten an der Kurveninnenseite nicht über die Thermoskanne zu pflügen. Denn enge Radien beherrscht die YZR-M1
bestechend und saugt sich beim Gasanlegen wie eingeklinkt auf der Innenbahn fest. Erst in knackigen Schräglagen findet das agile Monster zur Ruhe, mit verunsicherten Journalisten herumzugurken ist nicht ihr Ding.
Umso verwunderlicher, wie geschmeidig und gutmütig der Vierzylinder mit der schieren Kraft umgeht, sich ohne Hinterhältigkeiten mit dem Gaszug dressieren lässt. Scheinbar ohne Schwungmassen ausgerüstet, schnalzt der Motor durchs Drehzahlband, verbindet den spritzigen Charakter bissiger Zweitakter mit der
souveränen Drehmomentfülle kräftiger Viertaktbolzen. Leistung ist immer und überall im Überfluss zur Stelle. Womit Weltmeister Valentino Rossi 2004 in Sachen Schubkraft sicherlich gut bedient sein wird. Ob der Superstar allerdings mit dem feurigen, aber auch kapriziösen Handling, bedingt durch Yamahas eigenwilliges Motorenkonzept (siehe Kasten rechts), seine Dominanz fortsetzt, bleibt abzuwarten. Wobei durchaus möglich ist, dass genau dieses eigenständige Rezept bei richtiger Anwendung durch den Doktor der Yamaha-Truppe zur völligen Genesung verhilft.
Kreiselkräfte und ihre Wirkung - Yamaha YZR-M1 MotoGP-Rennmaschine
Mit dem Bauprinzip der rückwärts laufenden Kurbelwelle nutzt Yamaha als einziger Hersteller in der MotoGP-Klasse die physikalischen Gesetze rotierender Massen zur Verbesserung von Handling und Beschleunigung.
Man kennt es von allen längs eingebauten Motoren, wie bei BMW und Moto Guzzi: Ein Gasstoß, und schwups, klappt die Fuhre zur Seite. Die Ursache: Das Reaktionsmoment der Schwungmassen kippt das Fahrzeug entgegengesetzt zur Drehrichtung der Kurbelwelle. Ähnliches passiert bei der Yamaha YZR-M1. Da die rückwärts drehende Kurbelwelle quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist, zwingen die Kreiselkräfte das Motorrad vorn in die Knie, wirken also der Neigung zum Wheelie beim Beschleunigen entgegen und optimieren theoretisch somit die Sprintqualitäten. Noch massiver beeinflusst die Rotationsrichtung der Kurbelwelle das Handling der YZR-M1. Jedes rotierende Teil baut so genannte Kreiselkräfte auf, die es in seiner Rotationsebene halten wollen. Drehen sich zwei Wellen in entgegengesetzter Richtung, heben sich deren Kreiselkräfte im Idealfall komplett auf. Diesen Effekt nutzt Yamaha mit der rückwärts drehenden Kurbelwelle, welche die Kreiselkräfte der Räder zum Teil kompensiert. Das Resultat: Die Maschine lässt sich mit weniger Kraftaufwand in Schräglage bringen. Der Nachteil dabei: Die Yamaha ist bei einem Rutscher übers Vorderrad instabiler und kommt schneller zum Sturz.
Technische Daten - Yamaha YZR-M1 MotoGP-Rennmaschine
Motor: Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, 990 cm3, Leistung zirka 240 PS, Maximaldrehzahl 15000/min, zwei oben liegende Nockenwellen, über Kette und Zahnräder angetrieben, vier Ventile pro Zylinder, vier Flachschieber, elektronische Benzineinspritzung, automatische Standgasanhebung beim Bremsvorgang, Vier-in-zwei-in-eins-Auspuffanlage von Termignoni, Kurbelwelle rückwärts drehend, Zwischenwelle (Änderung der Drehrichtung) zur Anti-Hopping-Kupplung, Sechsgang-Kassettengetriebe, Rollenkette ohne O-Ringe.Fahrwerk: Alubrückenrahmen, Motor mittragend, Motorposition, Schwingenlager, Lenkkopfwinkel und Radstand variabel, voll einstellbare Öhlins-Upside-down-Gabel, gasdruckunterstützte Dämpfung, Brembo-Kohlefaserbremsen, Zweiarm-Aluschwinge mit innen liegenden Versteifungsrippen, voll einstellbares Öhlins-Federbein, Gewicht 145 kg ohne Tank (FIM-Reglement).