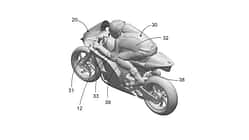Piep, pieeep, pieeeeep patsch, aus der blöde Wecker. Die spanische Sonne blinzelt knallrot durch die Jalousie, exakt sieben Uhr. In fünf Stunden und fünf Minuten ist es so weit. Eine halbe Ewig-keit hin und für einen Ex-Racer eigentlich eine lässige Aktion, weshalb der Ruhepuls noch keine Regung zeigt: 55 Schläge pro Minute zeigt der Pulsmesser die Schinderei auf der Motocross-Piste und end-
lose Mountainbike-Kilometer haben sich
gelohnt. Trotzdem habe ich jetzt, nach
Tausenden Runden auf zig Rennpisten mal ganz oben auf dem Stockerl, mal nur dabei , ein ganz schön mulmiges Gefühl. Was ist los? Valentino Rossis Yamaha
M1 wartet. 165 Kilogramm leicht, 250 PS stark, für den Überflieger konstruiert und um 12.05 Uhr für mich reserviert.
Neun Uhr. Freundliche Begrüßung mit kurzer Einweisung, neudeutsch Briefing. Die Yamaha-Techniker erklären in vagen Umschreibungen die Geheimnisse der Weltmeister-Maschine, beantworten konkrete Fragen mit freundlichem Schweigen, wünschen der Hand voll Journalisten viel Spaß mit Rossis Ross und warnen vor
den kühlen Temperaturen: »Vorsicht in
den wenigen Rechtskurven, vielleicht sind
die Reifen noch nicht warm genug.« Danke
für den Tipp: Puls 72.
Ich schleiche mich diskret in die Yamaha-Box. Doch außer den unter feinem Zwirn verhüllten Konturen des blauen Renners ist nichts zu sehen. Also bleiben nur Spekulationen und Meldungen aus Radio Fahrerlager. Was ist dran an der »Mission one«, kurz M1, von Yamaha?
Grob betrachtet ist alles beim Alten. Seit Beginn der MotoGP-Viertakt-Ära vertraut Yamaha auf einen konventionellen, zirka 20 Grad nach vorn geneigten Reihenvierzylinder. Von der Konkurrenz belächelt, die in exotische V5- und V4-Motoren investierte, zauberten die Yamaha-Techniker mit intelligenten Tricks und gigantischem Aufwand aus dem simplen Konzept ein Siegermotorrad. Der Physik wurde mit
der rückwärts drehenden Kurbelwelle ein Schnippchen geschlagen, das wirkt den Kreiselkräften der Räder entgegen, was der Yamaha einen Handlingvorteil verschafft.
Durch einen unkonventionellen Versatz der Hubzapfen erhielt der Vierventil-Motor die Zündabstände eines V4-Triebwerks. Das bringt zwar weder mehr Drehmoment noch mehr Leistung, doch die kompakter zusammengefassten Arbeitstakte des Vierzylinders gehen schonender mit dem Gummi des Hinterreifens um. Als Vibrationskiller dreht sich zwischen Kurbelwelle und Kupplung eine mit Ausgleichsgewich-
ten bestückte Vorgelegewelle, die zudem die scheinbar verkehrte Drehrichtung des
Motors korrigiert. Die reinste Augenweide: Das aus dem Vollen gefräste Aluminium-Gehäuse es repräsentiert den Wert eines Eigenheims mit Doppelgarage.
Wenn auch die kolportierte Höchstleistung von 250 PS beeindruckt, so steht bei Yamaha schon seit Jahren ein anderes
Ziel im Vordergrund: die Beherrschung der explosiven Urgewalt, die einen immen-
sen elektronischen Aufwand nötig macht. So liefert zwar der Fahrer immer noch
das Kommando vom Gasgriff aus, doch die komplexe Steuerung reduziert je nach Gangstufe und Drehzahl die Motorleistung durch mehr oder weniger geöffnete Drosselklappen und ein angepasstes Zünd- und Einspritzkennfeld. Dieses Puzzle geht so weit, dass ein Durchdrehen des Hinterrads fast vollständig verhindert wird. Was Nerven und Reifen schont, dem Publikum aber die spektakulären Drifts mit qualmenden Reifen vorenthält.
Die viel zitierte Fahrbarkeit ist auch
der Grund für die ständig modifizierten Fahrwerke beim MotoGP. Zum einen wird eine gewisse Flexibilität zur Dämpfung
kurzer Stöße und Schwingungen verlangt, zum anderen sollten die Räder durch
geringe Torsion des Chassis in der Spur gehalten werden. Eine Aufgabe, die auf unterschiedliche Weise gelöst werden kann, wie der Vergleich der Fahrwerke von 2004 und 2005 (siehe Seite 133) zeigt. Auffallend: Nach langen Versuchen mit überaus steifen 50-Millimeter-Upside-down-Gabeln haben sich Bauteile mit gerade mal 42 Millimeter Standrohrdurchmesser etabliert. Zum Vergleich: Yamahas Großseriensportler YZF-R1 hat 43-Millimeter-Rohre.
Wer glaubt, die Techniker hätten Rossis M1 mit extremen Fahrwerkswerten getrimmt, liegt völlig falsch. Stattliche 1460 bis 1490 Millimeter Radstand (YZF-R1: 1415 Millimeter) und 103 Millimeter Nachlauf bei 65,95 Grad Lenkkopfwinkel (YZF-R1: 97 Millimeter, 66 Grad) sorgen für eine stabile Grundlage. Der einzige gravierende Unterschied zum Serienbike dürfte der höhere Gesamtschwerpunkt aus Fahrer und Motorrad sein, was der Rennmaschine zu optimaler Traktion beim Beschleunigen verhilft.
Zwölf Uhr. Puls 105, ritsch, Lederkombi zu, Helm auf Ohrstöpsel nicht ver-
gessen , Handschuhe an, ein paar
Kniebeugen, dann wird »meine« M1 in die Startmaschine bugsiert. Ein kurzes Rasseln, ein Knall und die Luft brennt lichterloh. Jetzt gilts. Vier Runden, zügig laufen lassen, ausprobieren, was auszuprobieren ist, dem Fotograf eine zackige Schräglage auf die Linse brennen und vor allem: nix zerknittern. Keine Überraschung: die Sitzposition. Gut 860 Millimeter hoch, aber
locker entspannt, fast wie auf einer Serien-R1. Meister Rossi mags da eher gemütlich. Was von den Kohlefaserbremsen nicht behauptet werden kann, weil sich die Biester beim ersten Versuch einer Spätbremsung innerhalb von Sekunden von kalt auf heiß erhitzen und brutal verkeilen. Das Hinterrad in der Luft, das Kiesbett im Visier, torkelt die M1 auf der Notspur um die erste Kurve. Das fängt ja klasse an.
Dreimal tief durchatmen, sammeln, das Ganze von vorn. Na also, geht doch. Schon deshalb, weil dem Yamaha-Motor im Vergleich zum letzten Jahr auch die letzten Gewaltausbrüche und garstigen Drehmomentanfälle abgewöhnt wurden, weil jeder Gasbefehl das Geschoss mit
absolut linearer, kontrollierbarer Kraft nach vorne reißt, der Schaltautomat butterweich und kaum spürbar die Gangwechsel unterstützt. Kurz über 6000/min liefert der 990-cm3-Motor in den unteren Gängen verwertbare Kraft, ab 8000/min drückt es gewaltig voran, und einen Wimpernschlag später hebt sich in atemberaubender Beschleu-nigung sanft das Vorderrad vom Boden.
Wer dieses Signal nicht umgehend
mit einem Gangwechsel nach oben oder
leichtem Zurückdrehen am Gas pariert die Anti-Wheelie-Kontrolle schaltet dann ab dem schnalzt das Vorderrad mit aller
Wucht hoch. Eine der vielen auf Rossi abgestimmten Eigenschaften der M1, die bis etwa 13000/min lammfromm und vibrationsarm ihre Kraft umsetzt. Der Bereich, in dem kurvige, verzwickte Sektionen gefahren werden. Geht die Jagd schnurstracks geradeaus, kann der Champion im Bereich zwischen 14000 und 16500/min jede gewünschte und noch so biestige Leistung abrufen. Was dem Meister spielerisch von der Hand geht, treibt meinen Puls auf 152 Schläge ein Wert, der sonst nach einem hitzigen Motocross-Training anliegt.
Nein, das hier hat mit körperlicher
Anstrengung nichts zu tun, das ist der
pure Stress. Denn die M1 lässt sich aus dem Handgelenk dirigieren, im Fachjargon nennt sich so was kraftneutrales Fahren. Gut bürgerlich ausgedrückt: Der Fahrer denkt, die Yamaha lenkt. Egal, welche Schräglage, egal, welcher Radius, die M1 lässt sich mit minimalem Kraftaufwand um den GP-Kurs von Valencia segeln, sträubt sich in keiner Lage gegen die Lenkbefehle. Auch dann nicht, wenn es ans Limit geht. Ist bei Straßensportmaschinen ein klarer, progressiver Anstieg der Lenkkraft gewollt, um den Piloten vor dem Grenzbereich
in Schräglage zu warnen, verzichten die
Profis auf solche Eigenschaften. Mit der
Folge, dass sich die wirklich siegfähigen MotoGP-Bikes mühelos auf allen erdenklichen Kampflinien bewegen lassen.
Kurz und brutal ums Eck mit voller
Beschleunigung oder reifenschonend auf weichen runden Bögen die M1 ist gezüchtet, sämtliche je nach Rennstrategie notwendigen Manöver mit leichter Hand gelenkt zu erlauben. Nur so ist es auch zu erklären, dass Rossi von einem 15. Startplatz aus die Meute aufmischt und in
Valencia noch Dritter werden konnte. Und das macht die Fahrt auf der M1 selbst für normale Menschen zum reinen Vergnügen. Kraft, wann immer man will, Schräglagen bis zum Schwindelig werden und Bremsen, die im heißen Zustand zupacken wie Beißzangen. Das alles so transparent, so kontrollierbar so geil.
Auslaufrunde, Puls 110, zurück in der Box. Mechaniker Brent Stephens klemmt sich mit grimmigem Blick die M1 zwischen die Beine: »Sorry, vier Runden waren abgemacht, aber du bist zwei Runden mehr gefahren.« Oh, tut mir leid. Es ging wirklich alles Schlag auf Schlag...
Puls
Puls, Anspannung, Nervenflattern, noch ist alles im grünen Bereich. Und Zeit genug, Rossis blaue Wunderwaffe genauer zu analysieren
Das Namensschild
Das Namensschild für den Fotografen, noch einmal tief durch-atmen, die Rennkombi zurechtzupfen und
ab die Post
Im Tiefflug
Im Tiefflug durch die lange Linkskehre, danach hart rechts. Hoffentlich sind
die Slicks knackig
aufgeheizt wenn nicht: Abflug
Wie, zwei Runden zu viel?
Wie, zwei Runden zu viel? Ich würde eher sagen zwanzig Runden zu wenig. Trotzdem ein Dankeschön ans Yamaha-Team
Vergleich MotorLeistung
Für 2005 wurde die Leistung im mittleren Bereich reduziert und geglättet, über 13000/min aber drastisch erhöht (oben). In den unteren Gängen regelt die Elektronik die Leistung für eine bessere Fahrbarkeit zurück
Technische Daten
Motor: wassergekühlter Reihenvierzylinder-Motor mit asymmetrischem Zündversatz (Big Bang), vier Ventile pro Zylinder, elektronisches Motormanagement mit Schlupfregelung, Anhebung des Standgases beim Bremsen und Anti-Wheelie-Kontrolle, Anti-Hopping-Kupplung, Sechsgang-Kassettengetriebe mit Schaltautomat.
Fahrwerk: Lenkkopfwinkel 65,95 Grad, Gabelversatz 24 mm, Nachlauf 103 mm, Radstand 1460 bis 1490 mm, Gewicht nach FIM-Regeln 145 kg ohne 22-Liter-Tank, Alu-Brückenrahmen und -Schwinge aus Formpress- und Frästeilen verschweißt, vorn 42er-Upside-down-Gabel von Öhlins mit gasdruckunterstützter Dämpfung, am Motorblock abgestütztes Öhlins-Federbein mit stahlfederunterstützter Dämpfung anstatt Gaspolster, Magnesium-Schmiederäder, vorn 3.50 bis 3.75 x 16,50, hinten 6,25 bis 6,50 x 16,50 Zoll, Michelin-Slicks mit Multicompound-Laufflächen.
Saisonbilanz 2005
Jerez/E
Estoril/POR
Shanghai/CHN
Le Mans/F
Mugello/I
Barcelona/E
Assen/NL
Laguna Seca/USA
Donington Park/GB
Sachsenring/D
Brünn/CZ
Motegi/J
Sepang/MAL
Losail/Q
Phillip Island/AUS
Istanbul/TR
Valencia/E