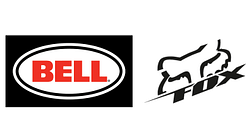Es fällt nicht schwer, sich im Untergrund Tokios außerirdisch zu fühlen. Ameisengleich wimmeln über acht Millionen geschäftige Japaner täglich nach einem undurchschaubaren, göttlichen Plan zwischen unzähligen Ebenen und Gleisen herum. Atemschutzmasken sind zur Schau getragene Skepsis gegenüber allem Infektiösen, was sich da in der Atemluft tummeln mag und gleichzeitig ein Symbol des ausgeprägten Sicherheitsbedürfnisses des Einzelnen. Ein Teil der großen Masse zu sein – das birgt nicht nur Schutz, sondern auch Gefahren. Der Japaner und die Sicherheit: Vielleicht ist das deshalb ein so zentrales, allgegenwärtiges Thema. Es gehört jedenfalls ebenso zu diesem bienenfleißigen Volk wie eine reibungslose Organisation. So gesehen ist ein Shoei-Helm ein typisch japanisches Produkt. Nicht nur, was die schützende Funktion, sondern vor allem, was die Produktion betrifft.
Selbstkontrolle als Bestandteil der Teamleistung
„Natürlich funktioniert ein Unternehmen nur dank der gemeinschaftlichen Anstrengung aller und nicht der einer einzelnen Person.“ Das betonte Eitaro Kamata, Shoei-Chef und Gründer schon im Vorwort zur Festschrift anlässlich des 30. Geburtstags. Der heute bereits 20 Jahre her ist. Weiter führte Kamata damals aus, dass man dieses Jubiläum nur feiern könne, weil alle daran mitgewirkt hätten. Es sei keineswegs ein Grund, stolz zurückzublicken oder die Gegenwart zu feiern. Im Gegenteil, das alles sei nur der erste Schritt in eine ungewisse Zukunft, und man dürfe nicht zögern, diesen Schritt zu gehen. Wer 2019, zum 50-jährigen Jubiläum, die zwei Shoei-Fabriken in Ibaraki (im Norden des Landes) und Iwate (südlich von Tokio unweit des Hauptstadt-Flughafens gelegen) besucht, spürt den seinerzeit von Kamata beschworenen Geist auch heute noch überall. Das überrascht – und ist nur möglich, weil in den Shoei-Fabriken keineswegs unzählige Helme von hochmodernen, voll automatisierten Fließbändern purzeln, sondern weil hier nach wie vor Menschen die gemeinsame Anstrengung unternehmen, alles Notwendige für die Qualität ihrer Produkte und die Sicherheit der anderen zu tun. Das sieht man ihnen an, das sieht man dem an, was sie tun – und wie sie es tun.

Die Shoei-Helmfertigung: Das ist nämlich eher Manufaktur als industrialisierter Prozess. Das sind rund 530.000 Helme im Jahr, von denen jeder einzelne durch viele japanische Hände ging, bevor er auf dem Kopf des Kunden landet. Er wurde gebacken, vermessen, lackiert und poliert, montiert und foliert und nochmals lackiert. Vor allem aber wurde er kontrolliert, immer wieder. Aber – und das ist ganz wichtig im Shoei-Kollektiv – nicht von Vermessungsrobotern oder Qualitätskontrolleuren, sondern direkt an den Arbeitsplätzen. Die Selbstkontrolle als Bestandteil der Teamleistung, der Name des zuständigen Mitarbeiters auf jeder Helmschale. Wer diesen Prozess beobachtet, ist nicht nur überrascht über das hohe Maß an Handarbeit und die Routine, mit der die zumeist langjährigen „Shoeiianer“ Helm für Helm entstehen lassen, sondern auch darüber, dass auf diese traditionelle Art und Weise immerhin über eine halbe Million Helme pro Jahr entstehen. Und noch etwas ist absolut erstaunlich. Diese für sich genommen dann doch beachtliche Stückzahl entspringt den gemeinsamen Anstrengungen von nicht viel mehr als 500 Mitarbeitern, denn die Zahl der Beschäftigten blieb über viele Jahre weitgehend konstant.
Langjährige Erfahrung trifft Kunden-Feedback
Da bewegen andere sich doch in ganz anderen Größenordnungen, auch wenn es darüber kaum verlässliches Zahlenmaterial gibt. Bei HJC rechnen Experten mit rund dem doppelten Ausstoß, Newcomer LS2 dürfte noch einmal in ganz anderen Sphären unterwegs sein. Was jedoch das Markenimage angeht, macht Shoei niemand etwas vor. Allenfalls die nationale Konkurrenz von Arai spielt noch in derselben Image-Liga, doch das ist kein Wunder. Schließlich kämpfen beide mit ganz ähnlichen Waffen. Allein dass Shoei nach wie vor ausschließlich in Japan fertigt, zeigt, worum es geht. Genauso wie das Material der Helmschale. Ein Shoei-Helm hat eine Schale aus hochfestem GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff), das billigere und leichter zu verarbeitende Polycarbonat (auf gut Deutsch: Plastik) war nie eine Option. Ganz egal, ob angesagtes Retro-Design (EX-Zero), Mittelklasse-Vollvisierhelm (NXR), Klapphelm (Neotec II) oder Rennsport-Schale (X-Spirit III). Bei dessen aerodynamisch-extrovertiertem Auftritt – das darf man getrost annehmen – werden die Hüter der Tradition mit den Aerodynamikern im firmeneigenen Windkanal trefflich gestritten haben. Oder, besser, diskutiert, denn eines darf bei einem so traditionsbewussten japanischen Unternehmen wie Shoei auch in diesen hektischen Zeiten nie passieren. Nämlich, dass jemand sein Gesicht verliert.

Das mag ein Hemmschuh sein, was Zeitgeist und Technologie-Transfer angeht, hinsichtlich der Produktqualität hingegen ist das Bewahren von Traditionen vermutlich ein Vorteil. Dass man bei Shoei eine neue Entwicklung verfrüht auf den Markt wirft, ist kaum vorstellbar, das Gegenteil hingegen schon. Auf der Motorrad-Messe in Tokio präsentierte man in diesem Frühjahr das erste Head-up-Display der Firmengeschichte. Aber nicht im Brustton der Überzeugung, damit genau die richtige Technologie für die Zukunft zu haben, sondern eher fragend. „Braucht man so etwas, braucht man es nicht?“ Im Zweifel setzen die Japaner eher auf die Erfahrungen und Bedürfnisse ihrer Kunden als auf die Predigten der Zukunftsjünger. Auch das hat im Hause Tradition und gilt im Übrigen für die Shoei-Helmentwicklung generell. Die Erfahrungen der schon lange Jahre im Hause tätigen Entwickler, kombiniert mit dem Kunden-Feedback – das ist der Leitfaden für die Produkte der Zukunft. Und welcher Teil eines Helms bedarf in dieser Hinsicht der besonderen Beachtung? Eine große Herausforderung sei bei jedem neuen Helm wieder die Visiermechanik, erklärt man uns vor Ort. Ein Gespräch mit den zuständigen Entwicklern sei jedoch aus Geheimhaltungsgründen nicht möglich. Die andere Herausforderung sei die Aerodynamik. Damit ist jedoch nicht in erster Linie die Geschmeidigkeit gemeint, mit der so ein Helm durch den Fahrtwind saust, sondern das komplexe Miteinander von Lüftungsein- und austritten und den unsichtbaren Kanälen, die nicht nur das Helm-Innenklima verbessern und somit den Tragekomfort erhöhen, sondern auch die Windgeräusche minimieren. Shoeis oberstem Werbeträger, Marc Márquez, dürften die hingegen ganz egal sein. Der will gewinnen, um jeden Preis. Und nicht einer sein unter vielen.
Weitere Fakten über Shoei
Am Anfang dachte noch niemand ans Motorrad, die ersten Helme von Shoei-Gründer Eitarō Kamata trugen 1954 – damals noch unter der Hersteller-Bezeichnung Kamata Polyester – Berg- und Bauarbeiter. Am 17. März 1959 folgte die eigentliche Shoei-Gründung, zunächst wurden Helme ausschließlich für den Rennsport hergestellt. 1968 folgte dann die Gründung der Shoei Safety Helmet Corp. Trotz seiner geringen Größe (461 Mitarbeiter) ist Shoei heute ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Umsatz von 17.148,76 Millionen Yen (139,49 Millionen Euro) und einem Ergebnis (nach Steuer) von 2.578,26 Millionen Yen (20,97 Millionen Euro). Bei dem großen Tōhoku-Erdbeben 2011 wurden beide Standorte schwer beschädigt und mussten teilweise wiederaufgebaut werden.